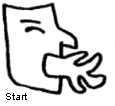


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
27.02.2013
Bericht zur Lage der deutschen Sprache
„Reichtum und Armut der deutschen Sprache“
Das öffentliche Interesse an der deutschen Sprache hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. In teilweise lebhaften Diskussionen wird über den Einfluss des Englischen, über den Verfall oder die Verarmung des Deutschen, über den Verlust an internationaler Geltung unserer Sprache oder die schwindende Bedeutung des Deutschen als Wissenschaftssprache gestritten.
Urteile über Probleme und ihre Ursachen sind schnell bei der Hand, häufig auch die unterschiedlichsten Therapievorschläge. Was bisher weitgehend fehlt, sind fundierte Diagnosen. Sie können dem politischen oder zivilgesellschaftlichen Engagement für die deutsche Sprache als Orientierung dienen und notwendige Schritte begründen. Sie können aber auch deutlich machen, dass auf bestimmte Maßnahmen besser verzichtet werden sollte.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften haben deshalb vereinbart, sich mit einem regelmäßig erscheinenden „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ an der öffentlichen Diskussion zu beteiligen. Der Bericht soll wissenschaftlich fundierte Information zu Themen liefern, die innerhalb des öffentlichen Diskurses von besonderem Interesse sind.
Der erste Bericht dieser Art behandelt unter dem Generalthema „Reichtum und Armut der deutschen Sprache“ folgende Einzelthemen:
1. Entwicklung des deutschen Wortschatzes (Ist die deutsche Sprache ärmer geworden?)
2. Anglizismen im Deutschen (Ist die deutsche Sprache durch den Einfluss des Englischen gefährdet?)
3. Die Entwicklung der Flexion (Büßt das Deutsche seinen Formenreichtum ein?)
4. Streckverbgefüge (Erstarrt das Deutsche in bürokratischem Nominalstil?)
Die Lage der deutschen Sprache wird in diesen Bereichen auf der Grundlage umfangreicher Textkorpora erfasst. Die Korpora sind so zusammengesetzt, dass sie als insgesamt repräsentativ für die geschriebene Standardsprache gelten können. Dabei wird einerseits Bezug genommen auf die Gegenwartssprache im engeren Sinn, d.h. das Deutsche um die Wende von 20. zum 21. Jahrhundert. Andererseits und mit gleichem Gewicht werden die Veränderungen im gesamten 20. Jahrhundert verfolgt, dargestellt und interpretiert. Eine ausführliche sprachkritische Bewertung wird auf der Grundlage der nun vorliegenden Untersuchungsergebnisse erarbeitet und gemeinsam mit ihnen in der Publikation vorgelegt.
Die Einzelprojekte werden von Mitgliedern der beteiligten Akademien geleitet, die gleichzeitig die institutionalisierte Forschung vertreten. Das sind aus dem universitären Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft: Frau Prof. Dr. Angelika Storrer (Dortmund) und Prof. Dr. Peter Eisenberg (Potsdam/Berlin), außerdem Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger, Direktor des Instituts für Deutsche Sprache Mannheim sowie Prof. Dr. Wolfgang Klein, Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen. Die sprachkritische Begleitung wird von Prof. Dr. Jürgen Schiewe (Greifswald) verantwortet.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Texten um die Vorstellung noch vorläufiger Ergebnisse handelt (Stand: März 2013). Der „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ wird voraussichtlich im Herbst 2013 erscheinen.
Quelle: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Link: http://www.deutscheakademie.de/aktuell3.html
| Kommentare zu »Bericht zur Lage der deutschen Sprache« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.09.2017 um 04.39 Uhr |
| Ich möchte meine alte Kritik erneuern: http://www.sprachforschung.org/index.php?show=news&id=688#9335 Beobachtungen zur deutschen Wortstellung usw. haben sicher nichts mit der "Lage" der deutschen Sprache zu tun, sondern allenfalls mit ihrem Zustand. So hat ja früher beispielsweise die hochdeutsche Lautverschiebung nicht die Lage des Deutschen verändert. Sollte eine Akademie für Sprache und Dichtung diesen Unterschied nicht kennen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.09.2017 um 08.47 Uhr |
| Den gesamten deutschen Wortschatz auszuzählen und statistisch zu bearbeiten hat wenig Sinn, weil er keine irgendwo existierende reale Größe ist. Zum Grundwortschatz: Wenn deutsche Muttersprachler aus dem Duden diejenigen 2000 Wörter heraussuchen, die ihnen intuitiv besonders wichtig vorkommen, erhält man eine Liste, die den aufwendig ermittelten statistischen Grundwortschätzen (Zertifikat usw.) an Brauchbarkeit nicht nachstehen. Das heißt, wenn man sie an verschiedene deutsche Texte anlegt, erzielt man einen ganz ähnlichen Deckungsgrad. Gerade die Mittelung über verschiedene Texte und Textsorten hinweg hat zur Folge, daß nur die Vielzweckwörter (Kernwortschatz und Argumentationswortschatz - vgl. mein Buch "Disziplinierung der Sprache") vollständig erfaßt werden, während natürlich jeder einzelne Text von ganz speziellen Gegenständen handelt, die logischerweise nicht erfaßt sind. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.09.2017 um 04.33 Uhr |
| Der Zweite Bericht wirft wieder die Frage auf, was diese Art von Nebenlinguistik eigentlich soll. Wolfgang Klein ist wieder zu vernehmen, Peter Eisenberg macht von außen den deskriptiven Standpunkt der wirklichen Sprachwissenschaft geltend, alles wie vor vier Jahren. Ein weiterer Band wird in die Institutsbibliotheken eingereiht, und dann vergißt man das Ganze. Wissenschaftlich satisfaktionsfähig ist der Bericht nicht und will es gar nicht sein. Mit der Erforschung der deutschen Sprache beschäftigen sich die Universitätsgermanisten, und dabei sollte es bleiben. Meinungen zu "weil" oder zum "Kiez-Deutsch" gehören in die Leserbriefspalte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.05.2014 um 09.58 Uhr |
| Auf der Website der "Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft" steht eine undatierte Erklärung zum "Sprachverfall": (https://dgfs.de/de/aktuelles/2012/erklaerung-der-dgfs-zu-sprachlichen-varianten.html) Auszug: In Deutschland wird derzeit eine Diskussion über Sprachvarianten des Deutschen geführt. Hitzige Debatten entbrennen zu der Vorstellung, das gute und richtige „Hochdeutsch“ sei derzeit einer Bedrohung ausgesetzt: Sprecher bestimmter Sprachvarianten könnten, so das Argument, kein richtiges Deutsch sprechen. Die Sprachvarianten, die hier genannt werden, sind oft Dialekte oder, in letzter Zeit, häufig bestimmte Formen von Jugendsprache, wie z.B. das Kiezdeutsch. Wenn diese sprachlichen Varianten gesprochen werden stehe, so die Befürchtung, ein Verfall der deutschen Sprache bevor. Nicht selten wird damit einhergehend auch ein Verfall anderer kultureller Werte beklagt. Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft ist die größte Vereinigung von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern im deutschen Sprachraum. Wir repräsentieren diejenigen Forscherinnen und Forscher, die in Deutschland professionell und um weltanschauliche Neutralität bemüht menschliche Sprachen (wie das Deutsche) untersuchen. Vor dem Hintergrund dieser Arbeit betrachten wir es als notwendig, zum eingangs genannten Thema Stellung zu beziehen: Die Behauptung, dass Sprachvarianz allgemein (oder einzelne Sprachvarianten im Besonderen) die Hochsprache gefährden, ist falsch. Zusammenhänge dieser Art werden zwar gelegentlich behauptet, sie entbehren aber einer wissenschaftlichen Grundlage. Der eingeschobene Absatz über die eigene Größe kommt mir reichlich geschmacklos vor. Am Schluß der hochgradig voraussehbaren Ausführungen heißt es: Reißerische Schlagzeilen wie „Das Deutsche stirbt aus“ halten daher näheren Untersuchungen nicht stand: Sie sind, aus der Perspektive genauer wissenschaftlicher Untersuchungen betrachtet, vielmehr dazu geeignet, Polarisierungen in einem Bereich zu verstärken, der großer wissenschaftlicher Sorgfalt und abwägender gesellschaftlicher Konsensbildung bedarf. Nanu? Was hat denn die "gesellschaftliche Konsensbildung" mit der zuvor beanspruchten Wissenschaftlichkeit zu tun? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.04.2014 um 07.35 Uhr |
| Eisenberg hat noch einmal eine Zusammenfassung vorgetragen, nebst sprachenpoltischen Vorschlägen: http://blog.wiwo.de/management/2014/04/07/die-anglizismen-sind-gar-keine-bedrohung-fur-die-deutsche-sprache-sagt-sprachprofessor-eisenberg |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.03.2014 um 17.33 Uhr |
| Zu #9318: Reihenweise räumte auch der Engländer Martin Durrell (Manchester) mit Vorurteilen über die deutsche Sprache auf. Er hatte schon im 18. Jahrhundert einen Beleg für den – später verpönten – Konjunktiv mit "würde" gefunden: "Ich glaubte, daß ich genug Zeit haben würde, die Hämorrhoiden zu stopfen." Kein gutes Beispiel. Es handelt sich nicht um den verpönten umschriebenen Konjunktiv, sondern zugrunde liegt Ich werde genug Zeit haben. Das dann in indirekter Rede:Ich glaubte, daß ich genug Zeit haben würde. Konjunktiv I wäre auch möglich, aber Konjunktiv II ist auf jeden Fall die sachgemäße Form von werden, des Futurs in der Vergangenheit. Ich trage das hier nach, weil ich gerade Martin Durrells Neubearbeitung von "Hammer's Geman Grammar and Usage" durchsehe. Sie ist "naturally" auf die revidierte Reformschreibung von 2006 umgestellt, s. Vorwort. Kein Wunder, bedankt er sich doch bei lauter reformiert schreibenden bzw. reformbesessenen Deutschen (Eisenberg, Eichinger, Stickel usw.). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2013 um 11.40 Uhr |
| Wie eigentümlich naiv die Verfasser (und schon der ganze Untersuchungsauftrag) sind, geht auch aus einem Interview Wolfgang Kleins mit dem Deutschlandradio hervor. Hier ein Auszug: Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen wieder den Aufruf höre, "jetzt können Sie voten", geht mir persönlich der Hut hoch. Ihnen nicht? Klein: Doch! Aber tadeln Sie nicht die deutsche Sprache dafür. Die deutsche Sprache hält nämlich die geeigneten Wörter dafür bereit. Deshalb verfällt die Sprache nicht, aber manche Leute machen halt einen schlechten Gebrauch von dieser Sprache. Ich verstehe auch nicht, wieso die Leute dann auf einmal voten statt wählen. Wahrscheinlich, weil sie sich sozusagen in eine gewisse Weltläufigkeit oder so etwas – weil sie das zeigen möchten. Aber das ist eine Sache, dass die Leute einen unguten Gebrauch davon machen oder einfach dieses ganze Potenzial nicht ausreizen oder, wie man neuerdings sagt, das Potenzial nicht abrufen, das die deutsche Sprache insgesamt hat. Da muss man aber die Leute tadeln und nicht die deutsche Sprache. Die deutsche Sprache ist davon nicht bedroht. Das Wort wählen existiert weiter. Hier wird die Sprache hypostasiert, als sei sie etwas anderes als das Sprachverhalten ihrer Sprecher. Wenn man das zu Ende denkt, könnte ein Wort in der deutschen Sprache "existieren", ohne jemals gebraucht zu werden. Vielleicht steht es dann in einem Wörterbuch, aber doch auch nur, weil es früher einmal gebraucht worden ist. Manche sprechen und schreiben besser als andere. Aber selbst hier würde ich nicht davon sprechen, daß sie ein "Potential" besser nutzen, denn was soll denn das heißen? Ist das zu verstehen wie die Möglichkeiten, die ein Musikinstrument bietet? Oder sind es die ungeschriebenen Verwendungsbedingungen, die unsere Altvorderen in die Wörter hineingepackt haben und die man nachvollziehen kann oder eben auch nicht? Und was fängt der Leser oder Hörer damit an? Man muß die Sprecher in Aktion beobachten, z. B. als Verfasser und Leser von Aufsatztexten, in denen sie neue Erkenntnisse verhandeln. Wie leicht fällt ihnen das? Welche Übung bringen sie von der Schule mit usw.? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.12.2013 um 11.11 Uhr |
| Hatte denn irgend jemand behauptet, der deutsche Gesamtwortschatz werde immer kleiner? Wenn man die Äußerungen der Verfasser des Berichts und die Kommentare der Journalisten dazu liest, könnte man es glauben. Sogar Anatol Stefanowitsch redet so ähnlich: "Der Wortschatz des Deutschen (und damit auch die Ausdruckskraft) wächst kontinuierlich, und zwar in allen vier Textsorten. Besonders interessant sind für mich dabei noch zwei Aspekte: Erstens ist der Wortschatz in der Belletristik in allen Zeitabschnitten am kleinsten und der Zuwachs ist insgesamt am geringsten. Das widerspricht ganz klar der Idee, dass Schriftsteller/innen in der Entwicklung von Sprachen eine besonders herausragende Rolle spielen. Zweitens scheinen es stattdessen die viel gescholtenen Journalist/innen und Autor/innen von Gebrauchstexten zu sein, bei denen es den größten Zuwachs gibt – und vielleicht ist das auch gar nicht überraschend, denn anders als Schriftsteller/innen sind sie ja gezwungen, sich mit der Welt und den Veränderungen darin immer direkt auseinanderzusetzen und für jede neue Entwicklung eben auch neue Wörter zu finden (bzw. aus dem Sprachgebrauch aufzugreifen). Aber in allen Bereichen gilt: Der Wortschatz der deutschen Sprache verkümmert nicht, er wächst und gedeiht ganz hervorragend." (Wozu ich bemerken möchte, daß ich mir unter der "Ausdruckskraft" nichts vorstellen kann, wenn sie nicht die Ausdruckskraft einzelner Sprecher ist, aber die haben noch nie unter einem Mangel an Wörtern gelitten.) Jeder kriegt doch mit, daß der Duden alle drei Jahre "5000 neue Wörter" aufnimmt, und die Ad-hoc-Bildungen in jedem Text kann man überhaupt nicht zählen. Was soll diese ganze Zählerei? Nur daß man es mit dem Computer so leicht machen kann, ist doch kein Grund, es auch tatsächlich zu machen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2013 um 06.29 Uhr |
| Woher Eisenberg seine gruseligen Angaben zum Analphabetismus im Kaiserreich hat, weiß ich auch nicht. Er selbst hatte jedenfalls in den "Osnabrücker Beiträgen" (OBST) vor 30 Jahren geschrieben, daß es um 1912 praktisch keine Analphabeten mehr im Deutschen Reich gegeben habe. Heute dürften es wieder mehr sein. Was bleibt da von den großartigen Fortschritten? Es sei auch noch einmal an die Zunahme der "Legasthenie" oder LRS erinnert, was immer man darunter verstehen mag. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.12.2013 um 06.10 Uhr |
| In einem früheren Bericht hatte der "Tagesspiegel" geschrieben: Nie zuvor haben die Deutschen so viel und so gut geschrieben wie heute. Sie beherrschen 1,6 Millionen Wörter mehr als vor 100 Jahren. (...) Eine Kritik an dem Bericht könnte lauten, dass er an der eigentlichen Problematik vorbeigeht. Internetblogs oder Chatgespräche flossen nicht in die Analyse ein, auf sie zielt jedoch die meiste Sprachkritik ab. „Genau diese Kritik hat aber das Standarddeutsche zum Maß“, sagt Eisenberg. Deshalb haben sich die Forscher darauf konzentriert und Verbesserung in allen Bildungsschichten festgestellt. Zum Vergleich: „Ein Soldat in der Armee von Kaiser Wilhelm konnte gerade mal seinen Namen schreiben.“ Ich beherrsche nicht 1,6 Millionen Wörter mehr als meine Urgroßeltern. Und die Alphabetisierung der deutschen Bevölkerung hat nichts mit Reichtum und Armut der deutschen Sprache zu tun (oder nur wenig und indirekt). Die beiden Berichte des "Tagesspiegels" verfälschen durchaus nicht die Botschaft der Forscher, die eben gar nicht recht wissen, was sie eigentlich mit dem Thema anfangen sollen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.12.2013 um 19.01 Uhr |
| Wie verkehrt man an den Gegenstand herangehen kann, zeigt eine Besprechung im "Tagesspiegel" (19.11.2013): Bei der Sprache fürchten Kritiker entsprechend ein nachlässiges Bildungssystem oder bequeme Ausflüchte ins Englische. Schnell fällt dann der Begriff „Spracharmut“. Für den ersten „Bericht zur Lage der deutschen Sprache“ haben vier Sprachwissenschaftler diese Vorwürfe untersucht – und empirisch widerlegt. Sie zeigen, dass sich die Deutschen heute vielfältiger ausdrücken können als je zuvor. Allein ihr Wortschatz ist in den letzten 100 Jahren um 1,6 Millionen Wörter gewachsen. Drücken sich die Deutschen heute vielfältiger aus als vor 100 Jahren? Ach so, sie "können" es nur, tun es aber nicht ... Was hat der einzelne Sprecher davon, wenn es irgendwo in der weiten Welt der Texte 5 oder inzwischen wohl 6 Millionen Wörter gibt? Es ist aber nicht Schuld der Rezensentin, sondern der in diesem Fall verantwortliche Wissenschaftler hat seinen Teil ganz auf diesen Ton gestimmt, auf das Imponieren mit riesigen Zahlen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.12.2013 um 04.38 Uhr |
| Horst H. Munske gibt in der FAZ vom 18.12.13 eine ausführliche, wohlwollend-kritische Besprechung des Buches. Seine Kritik deutet sich in der Anekdote von jenem Mann an, der seinen Schlüssel unter der Laterne sucht, weil es dort heller ist. Mehrmals kommt er darauf zu sprechen, was alles zum Thema gehört hätte, aber in diesem Band fehlt, auch die Folgen der Rechtschreibreform. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.11.2013 um 10.03 Uhr |
| Der "Bericht" wurde, wie die Zeitungen berichten, inzwischen auf einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt, die ebenfalls zum Gähnen gewesen sein muß. Der Bericht von Filmkritiker Andreas Kilb in der FAZ vom 20.11.2013 liegt noch mal eine Stufe drunter. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 28.05.2013 um 07.11 Uhr |
| Joachim Güntner widmete der Akademie Anfang Mai einen für Schweizer Verhältnisse fast schon ätzend zu nennenden Artikel in der NZZ: www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/nuetzlich-sein-statt-wichtig-tun-1.18076509 Ihr Versagen im Konflikt um die Rechtschreibreform kam dabei nicht zu kurz. |
Kommentar von Roger Herter, verfaßt am 19.04.2013 um 16.26 Uhr |
| Ja, müßte – wenn Ungebräuchliches richtig wäre. Man kann es aber auch deutsch sagen: Er ist studierter Ethnologe. Was soll daran weniger genau sein als die slawische Präzisierung mittels perfektivem Verb? Darum geht es doch: Sie werfen der deutschen Sprache mangelnde Ausdrucksfähigkeit vor, wo sie in Wirklichkeit etwas lediglich mit andern Mitteln sagt. Wenn der heutige Alltags- und Zeitunggebrauch hier unklar ist, liegt es jedenfalls nicht daran, daß uns die sprachlichen Möglichkeiten der Differenzierung fehlten. Die stehen zur Verfügung und sind ebenso eindeutig wie ihre slawischen Entsprechungen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 19.04.2013 um 09.30 Uhr |
| Mit dem sein-Perfekt wird das Verb studieren intransitiv, und das Studienfach müßte im Lokativ stehen: Er ist in ... studiert. |
Kommentar von Roger Herter, verfaßt am 18.04.2013 um 17.55 Uhr |
| Im Deutschen läßt sich der fragliche Sachverhalt sehr wohl präzise ausdrücken: Er ist studiert bedeutet, daß er sein Studium abgeschlossen hat, also Akademiker, ein Studierter ist. Allerdings scheint dieser unterscheidende Gebrauch heute eher als umgangssprachlich zu gelten, obwohl er im ganzen Sprachraum verbreitet ist. Seltsam. Das war früher offenbar anders. Hier ein Beispiel aus einem Stück von Friedrich L. Z. Werner von 1807 ("Martin Luther, oder die Weihe der Kraft"): Den laßt geh'n, – er ist studiert! – Er lief bey Melanchthon durch die Schule! |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 18.04.2013 um 13.25 Uhr |
| Der deutschen Sprache fehlt ein Wort für "ausstudiert" oder "fertigstudiert". In den Zeitungen steht sehr häufig, jemand habe das oder jenes "studiert". "Studiert" hat auch ein Studienabbrecher oder jemand ohne Abschlußprüfung. Lehrer slawischer Sprachen benutzen das gerne als Beispiel, wie aus dem unvollendeten Verb "studovati" mit dem Präfix "za" das vollendete Verb "zastudovati" wird, dessen aktives Perfekt "fertigstudiert haben" bedeutet, während das aktive Perfekt von "studovati" nur "studiert haben" bedeutet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.04.2013 um 05.05 Uhr |
| Ich erwarte unter einem "Bericht zur Lage der deutschen Sprache" eher etwas zur sprachenpolitischen Situation, nicht lexikologische oder grammatische Einzelheiten. Die könnte man unter "Zustand der deutschen Sprache" abhandeln. Nach langer leidvoller Erfahrung kann ich mir gut vorstellen, wie ein Gremium beisammensaß und nach einer Aufgabe suchte, die man ohne großen Aufwand bewältigen könnte, und dann auf die abgedroschenen Fragen kam, die nun dem angekündigten Ladenhüter zugrunde liegen sollen. Ich wüßte bessere Aufgaben, z. B. die Frage nach dem Gegenstand eines sinnvollen Deutschunterrichts. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.04.2013 um 05.44 Uhr |
| Der "Bericht zur Lage der deutschen Sprache", dessen Kurzfassung schon zu sehen ist, wird anscheinend aus vier Aufsätzen zu vier Einzelheiten der Gegenwartssprache bestehen und niemanden vom Hocker reißen. Solche Sachen schreiben ja unsere Germanisten sowieso jeden Tag, da braucht man keinen Sonderauftrag und große Presse. Die Millionenzuwächse im Wortschatz werden vor allem den Medien zugeschrieben, ich glaube aber eher, daß es die Fachsprachen sind. Wolfgang Klein schreibt: „Gehen auch Wörter verloren? Das ist sicher der Fall - großenteils, weil die dazugehörige Sache außer Gebrauch gerät. So taucht Droschke seit 1900 immer seltener auf. Allerdings halten sich viele „ungebräuchliche” Wörter wie alldieweil oder sintemalen bis in die Gegenwart; weiland nimmt sogar wieder deutlich zu. Gerade die mit der Ungewöhnlichkeit verbundene Anmutung bereichert wiederum die Ausdrucksmöglichkeiten, die das Deutsche bietet.“ Wolf Schneider hat vor vielen Jahrend treffend vom "mokanten" Umgang mit der Sprache gesprochen. Die auch von Uwe Förster gelobten "gehobenen" (= veralteten) Wörter kann und soll man niemandem verbieten, aber eine Bereicherung würde ich darin nicht sehen. Bei den Verlusten scheinen die Opfer der Political correctness nicht erwähnt werden zu sollen, so tabu sind sie... Nur die Rechtschreibreform ist noch tabuer. Dabei wären all diese Zwangsmaßnahmen gegen die deutsche Sprache wirklich mal einer Untersuchung wert, und sie wäre auch origineller als all dies Geschwätz, mit dem man gegen die Sprachverfallsthesen glaubt vorgehen zu müssen. Eichinger erkennt zwar den Rückbau der Genitivformen, meint aber, des Jahr sei nicht zu erwarten. Da wäre ich nicht so sicher. (Die Bistümer schreiben gern des Jahr des Glaubens.) Das allgemeine Lob des "Reichtums", von dem man nur Gebrauch machen müsse, scheint mir etwas naiv. Was bedeutet es, daß ich vielleicht 5000 Wörter verwende, aber aus 5 Millionen wählen könnte? Storrer will wieder mal zeigen, daß die Streckverbgefüge manchmal ihren guten Sinn haben. Sie weiß aber selbst, daß das zum Gähnen ist. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 06.04.2013 um 16.09 Uhr |
| Was an einer schnell hingeworfenen Bemerkung doch alles hängen kann! Einigkeit besteht wohl insoweit: Wenn z.B: die Shakespeare-Herausgeber drucken ließen "In characters as red as Mars his heart", hielten sie das für eine zumindest in den Freiheiten dichterischer Sprache akzeptable Ausdrucksweise und vermuteten nicht etwa einen zu korrigierenden Hör- oder Flüchtigkeitsfehler des Protokollanten. Ob Mars nun Genitiv oder Dativ ist, läßt sich nicht entscheiden. Die von Germanist angeführte Synkopentheorie erklärt nicht, warum die Apostrophschreibung sich spezifisch beim Genitiv durchsetzte und nicht bei der genau gleich gebauten Pluralendung (girl's ~ girls < girles) und anderen Formen (afterwards, nowadays – etymologisch ebenfalls Genitive!). Die von Herrn Ickler genannte Volksetymologische Theorie setzt das Bestehen der Apostroph-Schreibung voraus, bedarf somit einer Erklärung für deren Entstehen. Zudem wäre genauer zu prüfen, wann genau his-Schreibungen und Apostroph-Schreibungen nachweisbar sind (Henne oder Ei?). Baugh und Cable berichten in "A History Of The English Language", daß schon im 18. Jahrhundert heftige Kontroversen um die Frage der his-Genitive ausgetragen wurden. Die Autoren vertreten die Irrtums-Theorie: Wegen der lautlichen Ähnlichkeit der Genitivendung -es (schwachtonig -is) mit dem leicht sein h verlierenden his sei die Endung vom Wort abgetrennt und mißverstanden worden. Das Problem dabei: Die Schreiber müßten geradezu besessen gewesen sein von der Idee der his-Konstruktion und zudem ihre eigene Grammatik nicht verstanden haben. Einfacher erscheint mir, anzunehmen, daß sie tatsächlich meinten, was sie schrieben. Ein Lackmustest könnten die Feminina sein. Baugh/Cable führen mit Samuel Johnson an, daß Formen wie " a woman's beauty" nicht gut auf ein "his" zurückgehen könnten. Wir scheinen aber weitgehend einig, daß a) eine solche Formenübertragung durchaus möglich ist und b) nicht einmal notwendig, weil die Apostropschreibung in "echte" Genitive vordrang, als die Verwirrung da war und der Apostroph als ein Genitivkennzeichen verstanden wurde – eine willkommene Unterscheidung zum Plural; der Universalendung -(e)s drohte Überlastung, zumal auch die die Verbformen auf -(e)s wie rises, walks sich immer mehr ausbreiteten und schon vorherrschend geworden waren. Formen mit anderen Pronomina seien sekundär, meinen Baugh/Cable: "Logic was sometimes conciliated bei expressions like my sister her watch." (S. 241) Pinsker verweist stattdessen auf bereits frühneuenglische Belege wie "Untill the Utopians their creditors demaund it" und wahrscheinlich sogar schon Chaucer: "Here endeth the Wif of Bathe hir tale" (wenn tale ncht Akkusativobjekt ist, der Satz ist wegen der fehlenden Kasusmarkierung grammatisch zweideutig.) Eine andere Beobachtung als Indiz, daß die Engländer ihre Grammatik durchaus verstanden, also wußten, was eine Genitivendung ist: Beim prädikativen Gebrauch erhielten die Possesivpronomina, die nicht schon markiert waren, zusätzlich eine Genitivendung: This is your book <–> This book is yours This is his book <–> This book is hises (erst in neuerer Zeit durch einfaches his ersetzt, daneben gab es auch nach dem Vorbild von mine, thine gebildete youren, hisen usw.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.04.2013 um 05.47 Uhr |
| Ja, ich hatte ja auch gesagt, daß die volksetymologische Umdeutung des ererbten Genitiv-(e)s zu einer vorübergehenden Umgestaltung der Sprache geführt hat. Die Verallgemeinerung auf Formen, bei denen kein s gerechtfertigt war, macht auch keine Schwierigkeiten. Man könnte sich fragen, ob die "Logik" dahinter unserer Konstruktion "Dativ plus Possessiv" entspricht (dem Peter sein Auto) oder eher einem "Genitiv plus Possessiv" wie im Türkischen und vielen anderen Sprachen. Die Herleitung von Affixen aus enklitischen Wörtern ist ein durchgehendes Erklärungsprinzip bei John Horne Tooke, dem Vater der Grammatikalisierungsforschung, aber obwohl ich in der faksimilierten Wiedergabe seiner "Epea pteroenta" im Augenblick nichts dazu finde, nehme ich an, daß er in diesem Falle schon besser informiert war. Wie Sie inzwischen in den verschiedenen Einträgen bei Wikipedia usw. gelesen haben dürften, rechnen neuere Grammatiker das englische Possessiv-s nicht zu den Kasusendungen, sondern zu den Enklitika, und zwar weil es am Ende von Wortgruppen angehängt werden kann. Meiner Ansicht nach kein schlüssiges Argument, denn man könnte die Gruppen als Augenblicks-Univerbierungen deuten, wie im Deutschen des Grund und Bodens und viele ähnliche Fälle. Man darf sich da nicht von der Schreibweise irreführen lassen. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 05.04.2013 um 18.30 Uhr |
| Der Wikipedia-Artikel "His Genitive" bestätigt durchaus Pinskers Angabe, daß sich die his-Konstruktionen im Frühneuenglischen, also im 16./17. Jahrhundert sehr verbreitet hatten – die genauen Voraussetzungen für die Ausbreitung der Apostrophschreibung, die sich Ende des 17. Jahrhunderts allgemein durchgesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt verschwand die his-Konstruktion wieder – bestimmt kein Zufall. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 05.04.2013 um 18.05 Uhr |
| Die Kollision von natürlichem und grammatischem Geschlecht bei "Mädchen" ist vielleicht nicht das treffendste Beispiel (bei uns im Rheinland ist "es" und "sein" dafür ganz normal), eher vielleicht die Verbreitung von "sein" als Universalpossesivum (entgegen allen Feminisierungsbemühungen der Sprachreiniger und Sprachreinigerinnen). Zu ergänzen wäre vielleicht noch, daß "his" bis in die Barockzeit (als "its" erfunden wurde") auch das Neutrum darstellte, auch wenn "the tree his leaves" wohl nicht gerade häufig vorkam. |
Kommentar von Geermanist, verfaßt am 05.04.2013 um 17.39 Uhr |
| Also wie "meine Omma sein Auto". |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 05.04.2013 um 17.18 Uhr |
| Zu #9324–9327: "Die Herleitung des "sächsischen Genitivs" von "his" [würde] noch nicht seine Anwendung auf Feminina" erklären, ja, eigentlich auch nicht auf die Pluralformen (children's). Doch, das tut sie aber. Erst als "his" verkürzt zu "'s" nicht mehr als rein maskulines und Feminina und Pluralformen ausschließendes Possessivadjektiv empfunden wurde, hat es sich da als reines Possessivzeichen festgesetzt. Derartiges "overriding" grammatischer Bindung haben wir doch auch, wenn bei uns fast jeder im gesprochenen Deutsch bei "dieses Mädchen/Fräulein" mit "ihre neue Frisur" (oder was sie auch immer haben mag, jedenfalls nicht mit "sein") fortfährt. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 05.04.2013 um 15.37 Uhr |
| Meine Informationen nach Pinsker, historische englische Grammatik, S. 162/63. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 05.04.2013 um 14.13 Uhr |
| Die Herleitung des "sächsischen Genitivs" von "his" erklärt noch nicht seine Anwendung auf Feminina. Weiterführend ist die Untersuchung seines Vorkommens im Mittelenglischen und Frühneuenglischen: Das Mittelenglische zeichnet sich durch die sehr großzügige Anwendung von "e" aus. Man findet sehr häufig die Genitiv-Endung "-es". Im Frühneuenglischen werden diese vielen "e" weniger, und wahrscheinlich ist es beim Genitiv durch den Aopstroph ersetzt worden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.04.2013 um 11.19 Uhr |
| Das scheint eine alte volksetymologische Erklärung zu sein, die zeitweise tatsächlich zu einer Umgestaltung von Possessivkonstruktionen (wenigstens in schriftlichen Quellen) geführt hat. Vgl. Wikipedia unter "His genitive". |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 04.04.2013 um 20.10 Uhr |
| Übrigens ist der (angel-)sächsische Genitiv gerade aus Formulierungen des Typs "dem Peter sein Freund" entstanden: Peter his friend –> Peter's friend. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 04.04.2013 um 19.56 Uhr |
| Wenn die deutsche Sprache in den letzten vier- bis fünftausend Jahren gerade mal den halben Weg zur analytischen Sprache zurückgelegt hat, werden wir wohl noch eine Weile unsere Flexionsformen genießen können. Auch die Romanen werden sich auf absehbare Zeit mit sero – serai – sera etc. verständigen. Problematischer sind die gegenwärtigen Sprachwahrer, bei denen man wohl mit Poe sagen muß, die deutsche Sprache befindet sich in den Händen ihrer Feinde. In einem Radiointerview meinte wer, ich glaube es war der Chef des IDS, der Genitiv habe gar keine Existenzberechtigung, weil er mit zweimal s (des Hauses) überdeterminiert sei. Aber der sächsische Genitiv sei natürlich gut, weswegen er auch mit der Rechtschreibreform zugelassen worden sei – eher verhält es sich wohl umgekehrt: weil die Reformer ihrer Marotte frönten, muß man diese Neuschreibungen gut finden. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 04.04.2013 um 11.32 Uhr |
| Sorry, ich wollte sagen "Verfall des synthetischen Konjunktivs". |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 03.04.2013 um 22.33 Uhr |
| Nach meiner Meinung wird die deutsche Sprache auf dem halben Weg ihrer Entwicklung von einer synthetischen zu einer analytischen Sprache nicht einfach stehen bleiben, auch wenn uns das während unseres Lebens so vorkommt; dazu ist unser Leben zu kurz. Als Anzeichen dafür sehe ich z.B. den Verfall der Kasus-Endungen und des analytischen Konjunktivs. Es gibt ja Vorbilder: die romanischen Sprachen und das Neubulgarische mit seinem Ableger des Makedonischen, wo die Präpositionen die Kasus-Kennzeichnung übernommen haben. Außerdem hat das Makedonische als einzige slawische Sprache das "haben"-Perfekt hinzugenommen, das ist eine ganz moderne Entwicklung. Das Urindogermanische hatte keine Präpositionen, weil es acht unterschiedliche Fall-Endungen hatte für Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Lokativ, Instrumental, Ablativ und Vokativ. In einigen slawischen Sprachen sind Fall-Endungen zusammengefallen, weil die Präpositionen zur eindeutigen Kennzeichnung genügen. Das Englische hat die sonst doppeldeutige Präposition "in" aufgelöst in "in" und "into". So ist auch das "Wuchern" einiger deutscher Präpositionen zu erklären. |
Kommentar von WELT online, 22. März 2013, verfaßt am 03.04.2013 um 20.47 Uhr |
| Das Gefühl des Sprachverfalls trügt nicht Das Institut für Deutsche Sprache befasste sich auf seiner Jahrestagung mit dem Sprachwandel. Die Wissenschaftler fasziniert Veränderung, für den Normalbürger jedoch bedeutet sie einen Verlust. Von Dankwart Guratzsch Gibt es einen "Verfall" der deutschen Sprache? Stirbt der Konjunktiv? Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Macht das schludrige Denglisch dem reinen deutschen Idiom den Garaus? Ist die schauderhafte neue Rechtschreibung der Totengräber? Wo sind die Warner und Gesetzeshüter, die den Sprachverderbern das Mundwerk legen? Jedenfalls nicht im Institut für deutsche Sprache in Mannheim, nicht in der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und auch nicht in der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Der dreigeteilte Olymp der deutschen Sprachwissenschaft im Rhein-Neckardreieck ist ein Hochsitz ohne Götter, Mauern, Schwerter und Kanonen. Hier wird nur angesessen und Buch geführt. Und jedes Rascheln im Gesträuch klingt den Lauernden wie Musik in den Ohren. Was bei solcher Pirsch herauskommt, das hat der mit großer Spannung erwartete, vor drei Wochen publizierte "Bericht zur Lage der deutschen Sprache" erwiesen. Das Dickicht des Gegenwartsdeutschs, so befanden die Autoren, strotzt nur so von Leben. Der deutsche Wortschatz sei heute reicher als zu Goethes Zeiten, die Grammatik werde immer einfacher, die Anglizismen ließen sich verschmerzen und selbst die hässlichen Streckverbgefüge könnten auch manchmal sogar als sinnvoll erweisen. Mit anderen Worten: Die Jagd auf Symptome von Sprachverfall kann abgeblasen werden. Sprachwandel bedingt auch Verlust Als jetzt das Institut für Deutsche Sprache (IDS) auch noch seine Jahrestagung in Mannheim dem Thema widmete, wurde das Halali geblasen. "Es liegt im Wesen der Sprache, dass sie sich verändert, dass ihre Entwicklung in keinem Augenblick stille steht," hatte schon 1900 der große Sprachwissenschaftler Otto Behaghel gelehrt, und zu diesem Evangelium bekannten sich seine Kollegen auch in Mannheim. Denn Stillstand bedeute Tod. Zwar fiel der Verweis auf das vermeintlich tote Latein ein bisschen oberflächlich aus. Denn das lateinische Wörterbuch wird im Vatikan auch heute noch täglich um neue Wortschöpfungen ergänzt. Das Resümee der Linguistentagung berührte das jedoch nicht. Nur wer ganz genau hinhörte, konnte wahrnehmen, dass auch auf diesem Forum von etwas ganz anderem als in der deutschen Öffentlichkeit die Rede war. Für den Sprachwissenschaftler ist ja das Faszinosum an seinem Orchideenfach gerade der Wandel, ein "Richtig" oder "Falsch", ein "Gut" oder "Böse", ein "Schön" oder "Unschön" gibt es für ihn nicht. Für den Normalbürger aber geht es um Fülle, Farbigkeit, Feinheit im Ausdruck. Sein Leiden am Sprachwandel ist ein Leiden am Verlust. Werden Jugendliche in fünfzig Jahren überhaupt noch Goethe im Original lesen können? Oder sind ihnen bis dahin viele Vokabeln des Deutschen abhanden gekommen? Brauchen sie künftig Wörterbücher, um Kant, Lessing, Schiller, Kleist, Heine oder die Libretti der Wagneropern zu verstehen? Geht ihnen – und der Sprachgemeinschaft insgesamt – der direkte Zugang zum Kosmos der großen literarischen und philosophischen Kulturleistungen in deutscher Sprache verloren? Die Frage wurde in Mannheim nicht einmal gestellt. Dass sie eine Kernfrage des Deutschunterrichts an den Schulen ist, dessen Lehrer von denselben Linguisten ausgebildet werden, haben die Sprachwissenschaftler – um es mit einer jener neuen, bei den Fachvertretern so beliebten Wendungen zu sagen – nicht auf dem Schirm. Und das hat sehr gut nachvollziehbare Gründe. Feinste Veränderungen in der Wortwahl Allzu groß ist die Faszination der neuen digitalen Techniken, die ein Durchforsten der Sprache nach Erscheinungen des Wandels und der Veränderung erlauben, wie es so noch keiner Generation möglich war. Wenn zum Beispiel mit einem einzigen Tastendruck hundert Jahrgänge einer Zeitung auf eine (falsche) Wortbildung wie "schwörte" (für "schwor") durchsucht werden können, lassen sich feinste Tendenzen des Sprachwandels und flüchtigste Schwankungen mundartlicher oder modediktierter Varietäten in Sekundenschnelle mit Beispielen belegen. Mit welchem Eifer sich die moderne Linguistik dieses neuen Werkzeugs bedient, dafür bot die Tagung mannigfache, durchaus faszinierende Belege. Am verblüffendsten sicherlich, dass viele Erscheinungen des heute "gefühlten Sprachverfalls" seit Jahrhunderten beobachtet werden, ohne dass sie sich durchgesetzt hätten. Berühmt berüchtigt ist der Dativ auf "wegen". Sein vermeintlicher Vormarsch, so Ludwig M. Eichinger, Direktor des IDS, ist offenbar nicht nur ins Stocken geraten, sondern bewegt sich womöglich rückwärts – zumindest im Schriftlichen. Hier standen bei einer Untersuchung 25.669 Belegen für "wegen des" nur 2266 für "wegen dem" gegenüber. Eichinger vermutet: "Wegen dem" wird umgangssprachlich gebraucht, doch der Sprecher weiß sehr wohl, dass es grammatisch falsch ist. Mit anderen Worten, allem Kokettieren mit "Modernität" zum Trotz verwendet er die falsche Form mit schlechtem Gewissen. Beispiele dieser Art lieferte der Kongress die Fülle. So kommt es Marc Kupietz (IDS) so vor, als kündige sich sogar schon für Anglizismen ein "Abwärtstrend" an. Die hätten sich im Deutschen zwar seit 1995 verdoppelt, den Scheitelpunkt jedoch, zumindest in Österreich, anscheinend schon erreicht. Überhaupt misst der Forscher nicht dem Zeitfaktor, sondern dem jeweiligen Medium und der Region die größere Bedeutung bei der Ausbildung von Sprachvarianten bei. So verzeichnet der Sportteil der Zeitungen den mit Abstand höchsten Anteil an Anglizismen (möglicherweise unter Beteiligung der Allerweltsvokabel "Team"), während Parlamentsprotokolle (!) davon weitgehend frei sind. Statt "Dialekten" gibt es nun "Regiolekte" Reihenweise räumte auch der Engländer Martin Durrell (Manchester) mit Vorurteilen über die deutsche Sprache auf. Er hatte schon im 18. Jahrhundert einen Beleg für den – später verpönten – Konjunktiv mit "würde" gefunden: "Ich glaubte, daß ich genug Zeit haben würde, die Hämorrhoiden zu stopfen." Erst in den 1830er Jahren hätten so prominente Sprachwissenschaftler wie Johann Christoph Adelung und Karl Wilhelm Ludwig Heyse dann den Würde-Konjunktiv "aus dem Nichts heraus" auf den Index gesetzt – mit geringer Wirkung selbst auf einen Sprachmeister wie Thomas Mann. Und wie zum Beispiel steht um die Dialekte? Seit 250 Jahren, so Jürgen Erich Schmidt (Marburg), sagen Sprachkritiker ihr Absterben und damit die Einebnung regionaler Sprachvarianten voraus. Doch bei der Untersuchung des Sprachgebrauchs in 150 Orten bei drei unterschiedlichen Altersgruppen sei etwas ganz anderes herausgekommen. Die alten Grenzen und Barrieren der Dialekte erwiesen sich "auch aktuell noch höchst aktiv". Zwar seien die einstigen "externen Faktoren" für diese Grenzziehungen wie Religion oder staatliche Zugehörigkeit weggefallen, aber wo die Dialektkompetenz schwinde, übernähmen übergreifende "Regiolekte" ihre Rolle. Schmidts Folgerung klingt höchst überraschend: "Die alten Grenzen wirken weiter, durch die Anlagerung neuer Gegensätze vertiefen sie sich sogar." Und schnelles Umlernen auf einen anderen "Regiolekt" sei schlechterdings unmöglich: "Wenn ich versuchen wollte, wie Winfried Kretschmann zu sprechen, fehlten mir zehn Jahre Ausbildung." Vokabeln der deutschen Hochsprache schwinden Eine Erklärung für diese auffällige Beharrungstendenz von Spracheigentümlichkeiten im Deutschen will Renata Szczepaniak (Hamburg) am Beispiel der Karriere des Genitivs als Präpositionalkasus gefunden haben. Danach fungieren ambitionierte grammatische, dialektale und lexikale Formen im Deutschen vielfach als "soziolinguistische Marker". Zum Beispiel werde der Genitiv in Verbindung mit Dativpräpositionen wie "entgegen", "entsprechend", "gemäß" heute von Aufsteigern geradezu als "Prestigekasus" gebraucht. Ganz entgegen landläufigen Meinungen könne hier konstatiert werden: "Der Genitiv ist dem Dativ sein Tod" – und nicht etwa umgekehrt. Was aus alldem rückgeschlossen werden kann, ist vor allem für die (im Mannheimer Plenum reichlich vertretenen) Sprachrevolutionäre von 1968 fatal. Ihr Kampf für Einebnung der Sprache, gegen den "elaborierten Code" ist genauso gescheitert wie die von ihnen angezettelte Rechtschreibreform. Was einer ganzen Generation dadurch verbaut wurde, das ist die Teilhabe an eben jenem Bildungskanon, den die Reformer mit vermeintlichen Spracherleichterungen allgemein zugänglich machen wollten. Der Verlust an Vokabular der deutschen Hochsprache, der in Mannheim niemanden interessierte und der das alarmierendste Symptom für Sprach- (und Kultur-)verfall ist, hilft die Distanz zu diesem Bildungskanon nicht etwa überbrücken, sondern vergrößert sie noch. Und er steht nicht zuletzt auch der Integration von Migranten in die deutsche Kulturgemeinschaft wie eine Barrikade im Wege. Unvermindert scheint dagegen zu gelten, was es nach jenen Irrlehren gar nicht mehr geben sollte: Sprachkultur dient und wird eingesetzt als Ausweis kultureller Identität. Und deshalb kann Entwarnung in Sachen Sprachverfall, wie sie der "Bericht" nahelegt, keineswegs gegeben werden. Das Halali der Linguisten ist verfrüht. (www.welt.de/kultur/article114694278/Das-Gefuehl-des-Sprachverfalls-truegt-nicht.html) |