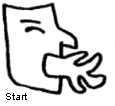


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
21.10.2005
Lob des Lobs der Rechtschreibung
Stefan Stirnemann bespricht Horst Haider Munske
Eine Vorbemerkung: Meine Besprechung ist recht lang geraten. Ich habe u.a. versucht, einige der besonders wichtigen Überlegungen Munskes in einen größeren Zusammenhang zu stellen und auf die Arbeit des Rates für Rechtschreibung auszurichten.
Der größere Zusammenhang ist das neunzehnte Jahrhundert, das ich in einigen Artikeln für die neue Auflage der Deutschen Biographischen Enzyklopädie dargestellt habe, über Konrad Duden, Karl Ferdinand Becker u.a. Das Urheberrecht dieser Besprechung liegt natürlich bei mir; wer nähere Angaben wünscht (etwa zur Literatur), wende sich an mich.
Lob verdient Lob
Ich lobe Horst Haider Munske für sein Büchlein ‚Lob der Rechtschreibung‘. Es ist löblich, zu loben, was viele nur aus Schulstunden kennen, die in besonders unangenehmer Erinnerung liegen: qualvoll gemischt aus wandtafeltrockener Langeweile und der Angst vor zahllosen Möglichkeiten, Fehler zu machen, sich lächerlich zu machen, schlechte Noten zu sammeln.
Munske ist ein Lehrer lobesam. Er pflanzt sich nicht auf und befiehlt Regeln; er führt seine Schüler durch das Land der Sprache und Schrift, zeigt breite Wege, verborgene Pfade und das eine oder andere fast unübersteigliche Hindernis. Da er die Sprache und ihre Geschichte kennt, da er auch mit der Sprachkunst wohlvertraut ist, kann er, wie er im Untertitel verspricht, erklären, „Warum wir schreiben, wie wir schreiben“. Der Schüler wird ernstgenommen, ein Kenner stellt sich mit ihm zusammen der Schönheit und Schwierigkeit des Schreibens.
Belobigt sei der Kenner vor allem dafür, daß er ein Büchlein der Freiheit geschrieben hat.
Er ist frei von allen Vorgaben der Kultusminister und Erziehungsdirektoren. Er ist aber auch frei von stolzem Auftrumpfen. Er zeichnet ruhig Entwicklungen nach und versucht sie verstehbar zu machen, und Kapitel für Kapitel ergibt sich der Schluß fast von selbst, daß es so, wie die Reformer wollen, nicht geht.
Was Munske im Kapitel ‚Groß oder klein?‘ schreibt, gilt für die ganze Untersuchung: „Es ist nicht meine Absicht, in diesem Buch die schon so oft formulierte Kritik an der jüngsten Rechtschreibreform zu wiederholen. Vielmehr geht es mir darum zu zeigen, daß der Weg der deutschen Rechtschreibung in den vergangenen 200 Jahren ein erfolgreiches Ringen um eine angemessene und differenzierte Wiedergabe des Deutschen mit den Mitteln der lateinischen Alphabetschrift war, ein Stück Sprachkultur, das man nicht einfach mit dem Argument beiseite wischen kann, das sei alles für Schüler zu schwer. Denn Vorrang haben hier die Leser und alle Autoren, die sich der bewährten Rechtschreibung bedienen wollen.“ (90 f.)
Aus dem Inhalt
Das erste Kapitel, die ‚Einführung‘, beginnt mit einem eigentlichen Psalm, den man laut lesen muß; in Munske steckt irgendwo ein Dichter: „Die deutsche Orthographie ist lobenswert. Lobenswert ist sie für die vielen guten Eigenschaften, die das Lesen erleichtern, ohne das Schreiben besonders schwer zu machen (…). Zu loben ist sie vor allem für ihre Einheitlichkeit, die in langer Tradition gewachsen und vor über hundert Jahren einvernehmlich besiegelt wurde (…). Ein besonderes Lob verdient sie für die Widerstandskraft, die sie gegenüber zahllosen Reformversuchen gezeigt hat. Dies dankt sie natürlich ihren Verteidigern, die sich nicht von platten Nützlichkeitsideen ins Bockshorn jagen ließen, die Ausdauer bewiesen und Überzeugungskraft…“ (9)
Nach einem gedrängten Überblick über Wesen und Geschichte unseres Alphabets folgt, besonders bedeutsam, das dritte Kapitel über die ‚Schrift als Symbol‘; Munske hat Gefühl für Sprache und kann die Gefühle anderer nachfühlen: „Kritiker werfen der widerspenstigen Bevölkerung Trägheit vor und Reformunwilligkeit. Vor allem die Alten hielten aus schierer Gewohnheit am Althergebrachten fest. Solche Vorwürfe gehen am Kern des Problems vorbei. Unsere Rechtschreibung wird mit allen ihren Besonderheiten von ihren Benutzern als Symbol der Muttersprache angesehen. Denn Sprache wird seit der Verbreitung von Lesen und Schreiben über das Geschriebene und Gedruckte identifiziert.“ (27) Ganz natürlich schließt sich eine Betrachtung über ‚Rechtschreibung für Leser‘ an: „Unsere Orthographie ist eine Leseschrift.“ (31) Munske greift hier auf Erkenntnisse des neunzehnten Jahrhunderts zurück; als man, wie heute, Reformversuche abwehren mußte, wurde das Wort geprägt: „Wir schreiben, um zu lesen.“
Das ausführliche fünfte Kapitel ist der ‚Laut-Buchstaben-Beziehung‘ gewidmet. Karl Ferdinand Becker, einer der großen Grammatiker des neunzehnten Jahrhunderts, schrieb: „Es gibt daher unter allen Dingen, die wir Zeichen nennen, wol Keines, das dem Bezeichneten auf eine so adäquate Weise entspricht, und mit ihm in solcher Weise Eins geworden ist, wie der Buchstabe mit dem Laute; wir verwechseln daher auch täglich das Eine mit dem Andern.“ Munske heilt uns von dieser Verwechslung, indem er einen anspruchsvollen Grundkurs in Laut- und Zeichenlehre erteilt. Die Schwierigkeit unserer Buchstaben-Zeichen bestimmt er so: Einerseits wird ein Zeichen für mehrere Laute verwendet (das Zeichen i für den langen und den kurzen Laut: Bibel, Bitte) – das macht dem Leser die Sache (ein wenig) schwer; er muß lernen, welcher Laut gemeint ist. Anderseits wird ein Laut mit mehreren Zeichen dargestellt (Riese, ihm, sieht, Bibel) – das macht es schwer für den Schreiber. Wir befinden uns im Quellgebiet der Dehnungszeichen, das immer wieder als Morast beschrieben wurde. Ein Vergleich mit Konrad Duden beleuchtet Munskes Haltung: Auch Duden zeigte die Schwierigkeiten der Beziehung von Laut und Buchstabe, rechnete aber besonders die Dehnungszeichen zur Willkür, die es zu bändigen galt. Folgerichtig schrieb er noch nach der Berliner Konferenz von 1901: „Der nächste Fortschritt wird uns von den noch übriggebliebenen Dehnungszeichen befreien.“ Munske möchte verstehen, nicht verändern, und vermerkt zu Unterscheidungen wie binnen/Bienen (eigentlich wäre Binen ausreichend), still/Stil/Stiel, lahm/Lamm: „Dies gehört in das weite Feld von Redunanz, von Überbestimmung in der Sprache, deren Sinn sich nicht systematisch bestimmen läßt. Eines kann man dazu aber erneut wiederholen: sie dient dem Leser.“ (49)
Munske zieht die Summe: „Die Markierung der Vokalquantität in der deutschen Orthographie ist ein Paradebeispiel für die verschiedenen Instrumente, die eingesetzt wurden, den Mangel an Quantitätsmarkierungen bei der Adaption der lateinischen Schrift zu beheben. Dies liefert auch Anschauungsmaterial, wie das Schreibsystem von unsichtbarer Hand verändert wurde. Kein Drucker und kein Minister, kein Verleger und kein linguistisch motivierter Reformer kann dafür verantwortlich gemacht werden.“ (56)
Es folgt eine Reihe von Kapiteln zu Bereichen, in welche die Reformer einzugreifen versuchen: ‚Stammschreibung‘, ‚Das ß‘, ‚Getrennt oder zusammen?‘ ‚Fremdwörter – fremde Wörter?‘ ‚Das Komma‘. Das ‚Kummerwörtchen daß‘ hat sich ein eigenes Kapitel verdient.
Es seien drei Punkte herausgegriffen, die in der Arbeit des Rates für Rechtschreibung besonders wichtig sind.
Erstens. Zum Eszett schreibt Munske: „Die bisherige Schreibung war die bessere, lange erprobt, leserfreundlich und gar nicht so schwer erlernbar.“ Um den Kultusministern einen ‚Ausweg aus dem selbstverschuldeten Dilemma‘ anzubieten, erwägt Munske hier einen Kompromiß, „der vielleicht von einer geduldigen Mehrheit akzeptiert würde.“ Zeitungen, Verlage und Behörden sollten aber die Freiheit haben, der bisherigen Eszett-Regel zu folgen, man werde dann sehen, was sich durchsetze oder ob die Varianz sogar erwünscht sei (68). Die Frage, was die Schule machen soll, bleibt offen. Beim Eszett wird oft die Schweiz erwähnt. Munske schreibt: „In der Schweiz wird überhaupt kein ß geschrieben, auch künftig nicht.“ Er verweist dazu auf einen Abschnitt aus Horst Sittas und Peter Gallmanns ‚Handbuch Rechtschreiben‘. Dort aber wird, abgesehen vom Hinweis auf das (angebliche) Fehlen dieses Zeichens in der Schweiz, das Eszett in seinem Gebrauch erklärt, das Eszett der Reform, versteht sich. Und im Vorwort sagen die Autoren: „Der Text kommt – natürlich – im Gewand der neuen Rechtschreibung daher; so wird beim Lesen über die neue Rechtschreibung diese zugleich vorgeführt.“ (Man muß hier in einer Klammer einfügen, daß das ziemlich gequältes Deutsch ist). „Das geht so weit, dass auch die ß-Schreibung verwendet wird, obwohl es das ß (Eszett) in der Schweiz weiterhin nicht gibt. – Hätten Sie es gemerkt, wenn wir es nicht offen gelegt hätten?“ (Handbuch, S.9) Auch in Walter Heuers „Richtigem Deutsch“, maßgeblich von Peter Gallmann betreut, wird das Eszett verwendet, erklärt und eingeübt. Da Gallmann umständehalber seit 1996 noch nicht dazukam, die vielen Übungen des Abschnitts „Wo steckt der Fehler?“ zu ersetzen, wird dort sogar immer noch das bisherige Eszett vorgeführt. Die Schweizer Schulbücher kommen zu einem beträchtlichen Teil aus Deutschland, die literarischen Bücher auch. Der Schweizer, der sein Buch im ganzen Sprachraum verkaufen möchte, druckt wie Horst Sitta und Peter Gallmann das Eszett. Es gibt das Eszett also in der Schweiz; viele Schweizer Schüler lesen es täglich, und es finden sich immer wieder welche, die es schreiben: ungezwungen, in aller Harmlosigkeit.
Die entscheidende Frage lautet: Was spricht eigentlich dagegen, diesen kleinen, schönen, nützlichen Buchstaben in allen seinen Möglichkeiten zu verwenden? Treffend schreibt Munske: „In ihrem gutgemeinten Bestreben, die Sprachgemeinschaft zu beglücken, sind echte Rechtschreibreformer unersättlich. Sie fänden erst endgültige Befriedigung, wenn völlige Einfachheit und Systematik erreicht würden. Diese vorgefaßte Haltung hindert sie auch, die Vermutung zu akzeptieren, daß sich vielleicht im Laufe der Zeit praktikable Kompromisse herausgebildet haben. (…) Im Grunde hindert sie nur eins, ihre Ziele offen zu bekennen und zu verfolgen: der erwartete Widerstand der Betroffenen. (…) So schielen Reformer stets danach, ob sich Widerspruch meldet, der ihr Vorhaben verhindern könnte, und sie erweisen sich als anpassungsfähig, sobald solche Gefahr ernstlich droht.“ (28) Das Eszett nahmen sich die Reformer deswegen vor, weil sie seine Stellung der Schweiz wegen für schwach hielten und guter Dinge waren, auf keinen Widerspruch zu stoßen. Der Reformer Hermann Zabel schrieb 1985: „Da die Einheitlichkeit im Bereich der s/ss/ß-Schreibung für den deutschen Sprachraum nicht mehr vorhanden ist, bietet sich eine Neuregelung dieses Bereichs geradezu an.“
Wenn wir diese Geßler-Narrenkappe grüßen, machen wir Geßler gewiß eine große Freude und ermuntern ihn zu weiteren Versuchen. Von William Stafford gibt es ein wortkarges Gedicht: My Name Is William Tell. My name is William Tell:/ when little oppressions touch me/ arrows hidden in my cloak/ whisper, „Ready, ready.“
Zweitens. Im Kapitel ‚Groß oder klein?‘ befaßt sich Munske ausführlich mit der sogenannten Artikelprobe (90 f): Ein Substantiv, also ein Wort, das groß zu schreiben ist, soll daran erkannt werden, daß die Verbindung mit einem Artikel möglich oder sinnvoll ist. Dagegen setzt Munske die Einsicht, daß der Artikel nicht nur ein Wort als Hauptwort kennzeichnet, sondern auch eine verweisende Aufgabe hat, im Sinne eines im Text vorerwähnt oder nicht vorerwähnt (77). Zusammen mit einem weiteren Wort bildet der Artikel oft sozusagen ein Pronomen: der eine, der andere, die zwei, der nächste bitte!. Schließlich steht der Artikel in festen Wendungen: des öfteren, im voraus. Wenn die Großschreibung dem Leser Wert und Rolle eines Wortes im Satz leichter erkennbar macht (Munske spricht von ‚morphologischen und syntaktischen Eigenschaften‘ eines Wortes, 79), so wirft, wer beim Artikel grundsätzlich groß schreibt, dem Leser ‚Stolpersteine‘ vor die Füße (89). Die Artikelprobe ist also grundsätzlich verfehlt, und zudem gilt sie nicht in allen Fällen; der Esel muß überlegen, ob er über die Brücke darf: „Es ist nur verwunderlich, warum normale Superlative wie am besten, am schönsten noch klein geschrieben werden, liegt doch auch hier das formale Kriterium eines (kontrahierten) Artikels vor. Die Schüler werden diesen Schluß bald ziehen.“ (90)
Worum es geht, macht Munske mit den folgenden Beispielen besonders deutlich: „Das nehme ich dir nicht im geringsten übel. – Auch der Geringste hat Anspruch auf ärztliche Hilfe.“ Erklärung: „Im zweiten Satz liegt echte Substantivierung des Superlativs von gering zur Bezeichnung von Personen vor, im ersten dagegen haben wir eine versteinerte Wendung vor uns, die mit dem Negationswort gar nicht synonym ist. Diese Parallelität führt zur Kleinschreibung.“ Die Unterscheidung ist alt; in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts beschrieb sie der Sprachkenner Daniel Sanders mit den Beispielen Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu einerseits und nicht im geringsten = durchaus nicht anderseits. Ein weiterer Blick auf die Anfänge unserer Sprachwissenschaft: Karl Ferdinand Becker hielt 1839 fest: „In den Ausdrücken: am besten, aufs freundlichste, aufs neue, von neuem, bei weitem, von fern, in kurzem wird jedoch das Adjektiv, obgleich es die Bedeutung eines Substantivs hat, weil der ganze Ausdruck nur in seiner adverbialen Bedeutung aufgefaßt wird, nicht mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben.“ Als ‚idiomatische Ausdrücke‘ verbuchte er u.a. es thut weh, es thut noth, es thut mir leid, jemanden zum besten haben. Was verbindet diese idiomatischen, eigentümlichen, Wendungen mit den adverbialen Ausdrücken? Sie werden mit fester Bedeutung häufig gebraucht, und sie entstehen und vergehen im Laufe der Zeit. Munske schreibt dazu: „In allen diesen Fällen geht es darum, daß die Rechtschreibung den Sprachwandel zu festen phraseologischen Einheiten nachvollzieht und dafür eine pragmatische Lösung findet, die bei abgeschlossener Entwicklung eine Schreibung fixiert, in Fällen des Übergangs aber angemessene Varianten zuläßt.“ (88) Dieses Begleiten des Sprachwandels macht, wie Munske sagt, eine „regelmäßige Anpassung im Sinne einer orthographischen Sprachpflege nötig“ (91). Hier, wie überall, wo echtes Leben ist, gibt es keine einfache Regel.
Munske vertritt den Standpunkt, den, seitdem es eine eigentliche Sprachwissenschaft gibt, alle ernstzunehmenden Forscher vertreten haben. Ein Gegenbeispiel: Der Reformer Hermann Zabel, den Munske im Zusammenhang anführt, erweitert die ‚Artikel-Probe‘, um sie besser handhabbar zu machen, zu einer ‚Wörterbuch-Artikel-Probe‘: „Ein Wort ist ein Substantiv, wenn bei Eintragung dieses Wortes in ein Wörterbuch ein Artikel voran- oder nachgestellt werden kann.“ Nun gibt es, meint Zabel, Wörter, die trotz ‚positiver Wörterbuch-Artikel-Probe‘ klein geschrieben werden, da sie heute anderen Wortarten angehören. Ausweg: „Es ist also zu prüfen, welcher Wortart diese Wörter heute zuzurechnen sind. Da diese Prüfung wiederum nicht unerhebliches grammatisches Wissen voraussetzt (was nicht bei allen Schreibern vorausgesetzt werden kann), empfiehlt es sich, sich die zu dieser Regel angebotenen Beispiele einzuprägen.“ Es wäre eine Überraschung, wenn im Rat für Rechtschreibung die Vertreter Österreichs und der Schweiz eine Veränderung dieser Reform-Regel zuließen.
Drittens. Im Kapitel ‚Getrennt oder zusammen?‘ bespricht Munske, um eine ‚oft mißverstandene Regel‘ zu klären, zwei Sätze: Die Versammlung ist nicht öffentlich und Dies ist eine nichtöffentliche Versammlung. (107) In Frage steht hier § 36 E2(1) der amtlichen Regelung (Fassung 2005): „Lässt sich in einzelnen Fällen (…) keine klare Entscheidung für Getrennt- oder Zusammenschreibung treffen, so bleibt es dem Schreibenden überlassen, ob er sie als Wortgruppe oder als Zusammensetzung verstanden wissen will, zum Beispiel: nicht öffentlich (Wortgruppe)/ nichtöffentlich (Zusammensetzung).“ Munske meint dazu: „Man kann (…) nicht sagen, das Wort würde (unlogischerweise) einmal zusammen, einmal getrennt geschrieben.“ (107) Er hält sich auch hier an die Sprachwirklichkeit, in welcher es die Zusammensetzung nichtöffentlich gibt (Munske vergleicht undeutlich) und die Wörter nicht und öffentlich, die im Satz nebeneinander stehen können. Die Wahl ist nicht frei, es kommt auf den Sinn an, den man ausdrücken will.
Auch diese Gegebenheiten sind im neunzehnten Jahrhundert ausführlich untersucht worden; zu einem verwandten Fall schrieb Daniel Sanders: „Der sogenannte oder wenigstens sich so nennende Baron war ein Schneidergeselle, wo sogenannt als die stehende Bezeichnung für einen zusammengefaßten Begriff zusammengeschrieben ist, dagegen die den Begriff zerlegende Bezeichnung sich so nennend als 3 Wörter.“
Zum ganzen Bereich schreibt Munske, und man beachte die feine Klammerbemerkung: „Erst die Debatte um die Rechtschreibreform hat (seitens der Kritiker) zu neuen Einsichten über den Wandel im deutschen Wortschatz geführt, den die Rechtschreibung natürlich auf ihre Weise abbilden muß.“ (13)
Der Rat für Rechtschreibung ist offenbar dabei, diese neuen Einsichten nicht umzusetzen, indem er Wortgruppe und Zusammensetzung als gleichberechtigte und gleichsinnige Möglichkeiten behandelt.
Soweit die drei Punkte.
Das Büchlein schließt mit einer ‚Charakteristik der deutschen Orthographie‘ und entläßt die Leser mit einer ‚Aufmunterung‘, einer Aufforderung, ‚Vertiefung und Mühe‘ auf sich zu nehmen: „Unsere Sprache und ihre Rechtschreibung sind solchen Aufwand wert.“ (130)
Munske lehnt es ab, die Rechtschreibung mit einem Kleid zu vergleichen; ein Kleid kann man wechseln. Auch damit steht er in einer guten Überlieferung; Daniel Sanders schrieb: „Hat man wohl hin und wieder die Orthographie ein Gewand der Sprache nennen wollen, so erscheint mir – man denke dies auch noch so eng dem Körper sich anschmiegend – die Bezeichnung jedenfalls zu äußerlich, zumal bei einer Schriftsprache mit ausgebreiteter Literatur. Die Orthographie ist vielmehr die Form, in welcher die Sprache dem Auge sich darstellt mit derselben Deutlichkeit, Klarheit und Bestimmtheit, wie das gesprochene Wort dem Ohre. Aus dem innersten Wesen der Sprache hervorgegangen; mit der lebendig sich entwickelnden sich fort- und umbildend; nie getrennt und nie zu trennen von dem gesprochnen Wort, dessen stetige Einwirkung sie erfährt, indem sie gleichzeitig darauf – minder hervortretend freilich – zurückwirkt, ist diese Darstellungsform der Sprache für das Auge gewiß mehr als ein bloßes Gewand, das etwa mit einem andern vertauscht werden könnte.“
Munske nennt die Rechtschreibung „die Haut der Sprache“. (128)
Rettung kommt aus Erlangen
In Erlangen wirkte von 1826 bis 1841 der Dichter und Sprachforscher Friedrich Rückert. Sein Gedicht ‚Die Sprache und ihre Lehrer‘ beginnt so: „Die Sprache ging durch Busch und Gehege,/ Sie bahnte sich ihre eigenen Wege./ Und wenn sie einmal verirrt’ im Wald,/
Doch fand sie zurecht sich wieder bald./ Sie ging einmal den gebahnten Steg,/ Da trat ein Mann ihr in den Weg./ Die Sprache sprach: Wer bist du Dreister?/ Er sprach: Dein Lehrer und dein Meister./ Die Sprache dacht’ in ihrem Sinn:/ Bin ich nicht selber die Meisterin?“
Allein der Lehrer ist anderer Meinung:
„Der Meister sprach in einem fort,/ Er ließ die Sprache nicht kommen zum Wort.“
Dieser Lehrer ist ein Reformer der Rechtschreibung. Wer denkt hier nicht an Prof. Dr. Gerhard Augst, welcher der Sprache die Schreibweise „in einem Fort“ aufschwatzen wollte?
In Erlangen wird auch heute besser über unsere Sprache nachgedacht als anderswo. Wenn sich demnächst das Getümmel gelegt hat und der Qualm verflogen ist, stehen Horst Haider Munske und Theodor Ickler da, keineswegs schwarz von Pulverdampf und unversehrt von Rippenstößen, die sie einstecken mußten. Wer unbefangen ihre Untersuchungen liest, wer jetzt besonders Munskes Büchlein liest, wird erkennen, daß hier ein Weg und Ausweg gewiesen wird.
Aus Potsdam winkt Eisenberg, andere von anderswoher: lauter Wissenschaftler, die an Schulen und Universitäten in dem Rahmen forschen, den der Staat sichert: Was wollen die Politiker mehr? Wozu braucht es noch Kommissionen oder Räte, deren Forschungen auch dann amtliche Gültigkeit erhalten, wenn sie in einem Fort verbessert werden müssen?
Solange es aber einen ‚Rat für Rechtschreibung‘ gibt, muß ein Munske Mitglied sein.
Die wichtigste Frage ist jetzt, was an den Schulen unterrichtet wird. Munske schreibt: „Während die Rechtschreibdebatte zwischen 1850 und 1901 zahlreiche Sprachwissenschaftler und Schulmänner zu einer intensiven Beschäftigung mit der deutschen Orthographie angeregt und zu außerordentlich kompetenten Darstellungen und Kommentaren geführt hat, die noch heute lesenswert sind, verfiel dieses Wissen nach 1901.“ (92) Nur deswegen, weil man die Rechtschreibung nicht mehr im Zusammenhang mit der lebendigen Sprache sah, wurde sie als Qual und Zwang empfunden. Nur deswegen konnte der Duden als Gesetzbuch mißverstanden werden, nur deswegen konnten die Reformer mit ihren weitgehend verfehlten Überlegungen eine ganze Sprachgemeinschaft verblüffen. Mit dem Duden geht Munske übrigens wohltuend maßvoll um; er hält ihm ‚Überregulierung‘ vor, die aber keine Reform, sondern eine neue Regeldarstellung nötig macht (92).
Herausgefordert ist vor allem die Universität, da sie die künftigen Lehrkräfte fachlich ausbildet. Die Leitworte für die anstehende Arbeit kommen aus Erlangen: ‚Orthographie als Sprachkultur‘ (Munske) und ‚Orthographie als Entdeckungsverfahren‘ (Ickler).
Wie geht das? Nach Munske so: „Es ist frustrierend, ausführliche Regeln mit zahllosen Beispielen zu lesen, aber es kann vergnüglich sein, den Gebrauch des Kommas bei den Klassikern von Lessing bis Grass zu studieren. Sie zeigen uns zuverlässig und kreativ, wie die Satzzeichen Stil und Grammatik unterstützen und sichtbar machen.“ (122)
Die Sprache lebt, die Rechtschreibung lebt auch. Mit seinem lebendigen ‚Lob der Rechtschreibung‘ hat uns Munske ein Büchlein in die Hand gegeben, das ein Handbüchlein im besten Sinne des Wortes bleiben wird.
Berichtigungen
Für die nächste Auflage sind einige Fehler zu berichtigen: Boxhorn (9), die Rücksicht, welche die Gremien geleitet haben (statt: hat, 91), die Trennung da-rum (76). Einmal fehlt ein Fragezeichen im Titel (49) und weitere Kleinigkeiten. Im Abschnitt 9.5 ist irrtümlich dreimal von der geplanten Neuregelung die Rede (91, 92, 93). Eine Anrede an den Leser kommt gegen Ende des Buches sehr überraschend (95). Die Liste von Wörtern, deren Kleinschreibung 1901 vereinbart wurde, muß überprüft werden (82); Duden verbuchte 1911 das Folgende, das Vorstehende (also nicht klein). Adolf Hitler hat die Fraktur 1941 abgeschafft, nicht 1942 (27, 76). Im Literaturverzeichnis sollte die einschlägige Untersuchung von Birken-Bertsch/ Markner erwähnt werden und unbedingt Theodor Icklers ‚Kritischer Kommentar‘.
Stefan Stirnemann, St. Gallen, 21. Oktober 2005
Horst Haider Munske
Lob der Rechtschreibung
Warum wir schreiben, wie wir schreiben
Verlag C.H.Beck, München 2005
ISBN 3-406-52861-9
Euro 9,90
| Kommentare zu »Lob des Lobs der Rechtschreibung« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Karsten Bolz, verfaßt am 22.10.2005 um 12.18 Uhr |
| Lieber Herr Stirnemann, nur drei kurze Anmerkungen zu Ihrer gelungenen Rezension. Sie schreiben: '... wurde das Wort geprägt: "Wir schreiben, um zu lesen."' Sollte es nicht heißen: "Wir schreiben, um gelesen zu werden."? In der Folge 'Riese, ihm, sieht, Bibel' sollte das i in 'ihm' wohl auch kursiv gesetzt sein. Und abschließend: 'In Frage steht hier § 36 E2(1) der amtlichen Regelung (Fassung 2005)' Die Fassung ist doch aus 2004. |
Kommentar von Karsten Bolz, verfaßt am 22.10.2005 um 12.49 Uhr |
| Nach nochmaliger Lektüre stehe ich jetzt doch an einer Stelle etwas ratlos dar: Um den Kultusministern einen ‚Ausweg aus dem selbstverschuldeten Dilemma’ anzubieten, erwägt Munske hier einen Kompromiß, „der vielleicht von einer geduldigen Mehrheit akzeptiert würde.“ Zeitungen, Verlage und Behörden sollten aber die Freiheit haben, der bisherigen Eszett-Regel zu folgen, man werde dann sehen, was sich durchsetze oder ob die Varianz sogar erwünscht sei (68). Die Frage, was die Schule machen soll, bleibt offen. Vielleicht verstehe ja nur ich es nicht: Welchen Kompromiß erwägt Munske? Die bisherige Eszett-Regel ist es offensichtlich nicht, sonst wäre das Wort "aber" im Satz "Zeitungen ... sollten aber die Freiheit haben..." irreführend. Wenn Munske einen Kompromiß erwägt, um den Kultusministern einen ‚Ausweg aus dem selbstverschuldeten Dilemma’ anzubieten, wieso bleibt dann offen, was die Schule machen soll? Die Kultusminister haben doch die Verantwortung für die Lehrpläne an den Schulen. Was habe ich da mißverstanden? |
Kommentar von Stefan Stirnemann, verfaßt am 22.10.2005 um 19.17 Uhr |
| Zu Karsten Bolz Vielen Dank für die Hinweise. Die Schrägschrift bei ihm habe ich tatsächlich verpatzt. Als ich noch beim lateinischen Wörterbuch Thesaurus in München arbeitete, galt es ab und zu ein Komma zu kursivieren. Ich war froh über erfahrene Redaktoren. Die gedruckte Neufassung des Regelwerks gibt es erst seit August 2005: die Brüder und Schwestern sind noch haarscharf zum Ende der Übergangsfrist fertig geworden damit. Ihre 'Vorbemerkung' haben sie auf den November 2004 festgelegt; vielleicht hat die Kommission aber noch nach ihrem Untergang an den 'Modifizierungen' gearbeitet. "Wir schreiben, um zu lesen": Der Aphorismus lautet so; man muß sich an die etwas gesuchte Kürze gewöhnen. Zum Kompromiß: Herr Munske erwägt, ob man die 'neue' Eszett-Regel hinnehmen soll. Wenn Zeitungen, Verlage und Behörden das bessere Eszett schreiben, kann man die Schule nicht notenwirksam auf etwas anderes verpflichten; insofern ist für mich offen, was die Schule macht. |
Kommentar von Karsten Bolz, verfaßt am 23.10.2005 um 11.24 Uhr |
| Danke für die Aufklärung, Herr Stirnemann. Dennoch muß doch die gedruckte Fassung aus 2005 mit der im Internet verfügbaren Fassung von 2004 inhaltlich identisch sein. Bei der KMK liest es sich wie folgt: NS 310. KMK, 02.06.2005, [...] (1) Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, wie sie sich aus der Amtlichen Regelung von 1996 in der Fassung von 2004 ergibt, ist die verbindliche Grundlage des Rechtschreibunterrichtes an allen Schulen. Oder anders gesagt: Die Fassung stammt doch immer noch aus 2004, selbst wenn sie erst im Jahr 2005 in Druck ging. |
Kommentar von Horst Haider Munske, verfaßt am 26.10.2005 um 10.55 Uhr |
| Die Fehlschreibung "Boxhorn" (statt richtig "Bockshorn"), auf die mich Herr Stirnemann in seiner wunderbaren Besprechung hinweist, ist natürlich ein dummer Fehler, vermutlich eine persönliche Erinnerung an meinen Heimatort "Boxberg". Besser ist eine andere Erklärung, die auf die Dynamik unserer Rechtschreibung hinweist. "Bockshorn" in der phraseologischen Wendung 'jemanden ins Bockshorn jagen' ist nicht mehr motiviert. Keiner weiß, was das Bockshorn ist, braucht es auch garnicht zu wissen, denn die Bedeutung wird von der ganzen Wendung getragen. Diese Demotivation führt nun auch dazu, die Schreibung von dem Zusammenhang mit 'Bock' zu befreien und an der einfacheren Schreibregel So zitiert Wander in seinem Deutschen Sprichwörterbuch Band 1, S. 419 aus einer Sammlung schlesischer Redensarten von 1726: "Fur oich krich ich in kee Buxhurn". Der Usus der Rechtschreibung ist auch ein Prozeß der Anpassung an die sich wandelnde Sprache. Fehlerhafte Varianten sind die ersten Signale dafür. Aber: Ceterum censeo, den Staat geht das nichts an. |
Kommentar von Jürgen Langhans, verfaßt am 27.10.2005 um 10.45 Uhr |
| Es ist erfrischend, wieder einmal ein Buch, das in gutem Deutsch verfaßt ist, lesen zu können. Unabhängig davon entspricht der Inhalt voll und ganz den Erwartungen eines anspruchsvollen Lesers, der wissen will, warum wir so schreiben, wie wir heute schreiben. In angenehm sachlicher und überaus kompetenter Art und Weise erläutert der Autor die geschichtlichen Aspekte unserer Rechtschreibung und Grammatik. So erfahren wir beispielsweise, warum wir „im allgemeinen“ und nicht – wie es heute in den Schulen gelehrt wird – „im Allgemeinen“ schreiben müssen. Wir lesen über die Nützlichkeiten der Großschreibung, des „ß“ und des „daß“. Der Autor zeigt anschaulich an Beispielen die Stärke unserer Schriftsprache, wenn es um die Unterscheidung der Bedeutung von Wörtern mit gleicher Aussprache geht, z. B. „Moor“ und „Mohr“. Es bleibt kein wichtiges Teilgebiet der Rechtschreibung ausgespart. Natürlich kommt der Autor an der sog. Rechtschreibreform nicht vorbei. Er arbeitet klar heraus, daß das Rechtschreiben dem Lesen dient und nicht das „Vereinfachen“ des Schreibens zum Ziel hat. Als belesener Bürger weiß man das natürlich, aber die im Buch dargelegten Zusammenhänge und Fachbegriffe erweitern ungemein die eigenen Argumentationsmöglichkeiten gegen diese absurde Reform. Fairerweise nennt der Autor auch „Nachteile“ der „ß“-Schreibung und gibt außerdem zu bedenken, daß jemand, der „ss“ statt „ß“ schreibt, vom Grundsatz her natürlich keinen grammatikalischen Fehler macht. Aber je tiefer man in die Lektüre eindringt, desto unfaßbarer erscheint einem das Bestreben einer Minderheit von „Reformern“, dieses so wertvolle und über Jahrhunderte auf natürliche Weise ausgereifte, sensible Kommunikationsprodukt auf Dauer zerstören zu wollen. Auch wenn ich den im Buch vorgestellten Kompromißvorschlag zur „ss“ / „ß“-Schreibung persönlich nicht mittragen will, lautet mein Fazit: Ein sehr empfehlenswertes und wichtiges Buch! |
Kommentar von F.A.Z., 10.08.2011, Nr. 184 / Seite N4, verfaßt am 13.08.2011 um 11.35 Uhr |
| Die optimale Sprache dem Kint mit Leffeln eintrichtern Vor hundert Jahren starb Konrad Duden, dessen Ansichten zur Rechtschreibung nicht viel mit dem zu tun haben, wofür der Name heute steht. Die Geschichte seines Reformwerks steckt voller Merkwürdigkeiten. For hundert jaren starb Konrad Duden, ferert als fater der orthografie. Der Mann, dessen Name zum Synonym für buchstäbliche Korrektheit geworden ist, hätte diese Schreibweise nicht als Affront empfunden. Duden war ein Anhänger der „phonetischen Schule“, er träumte von einer Schreibung, in der jedem Laut nur ein Buchstabe entspricht und umgekehrt. „Schreib, wie du sprichst“ war das Prinzip dieser orthographischen Utopie, die freilich voraussetzt, dass alle Menschen ein standardisiertes Hochdeutsch sprechen. Dass zu seiner Zeit noch die Dialekte den Alltag bestimmten, hielt Duden für ein bald überwundenes Hindernis. Seinem Ideal am nächsten kam die ziemlich lautgetreue italienische Orthographie, die er als Hauslehrer in Genua kennengelernt hatte. Als abschreckendes Gegenbeispiel dienten ihm die Unregelmäßigkeiten der englischen Rechtschreibung; das deutsche Schriftsystem verortete er zwischen diesen Polen. Es zu einer volksnahen, „demokratischen“ Rechtschreibung weiterzuentwickeln, die bildungsferne Schichten von den Mühen komplizierter Regeln erlöst, war sein Ziel. Unter Arbeitern und Bauern wüte die herrschende Orthographie wie die Pest - das hat nicht Duden gesagt, sondern, in einem „Spiegel“-Artikel von 2005, der Kopf der jüngsten Orthographie-Reform, Gerhard Augst. Die soziale Begründung mit ihrer Gleichsetzung von Demokratie und Simplizität ist bis heute der Evergreen der Reformer. Außerhalb der Buchstabenwelt stand Duden selbst aber linken Neigungen durchaus fern. Als Student hatte er sich zwar für die Ziele der versuchten Revolution von 1848 begeistert, doch nach ihrem Scheitern setzte er, wie viele Nationalliberale, auf das autoritäre Preußen als Motor der politischen Vereinigung Deutschlands. Der Schuldirektor Duden war loyaler Monarchist, der seinen Liberalismus auf das Private beschränkte. Sozial engagiert, lehnte er die Sozialdemokratie zutiefst ab. Zu Beginn der siebziger Jahre, als Duden zum Reformaktivisten wurde, stritten Germanisten und Lehrer schon seit Jahrzehnten über die Orthographie. Eigentlich waren diese Kontroversen überflüssig, denn es gab - ganz ohne amtliche Regelungen - eine leidlich funktionierende Schreibung, die trotz mancher Varianten schon weitgehend vereinheitlicht war. Sie hatte sich im Laufe der Jahrhunderte aus der Praxis der Schreiber, Drucker und Korrektoren entwickelt. Der Grammatiker Johann Christoph Adelung goss sie Ende des achtzehnten Jahrhunderts in Regeln. Sein Wörterbuch, „der Adelung“, war eine Art Duden vor dem Duden. Dass die Orthographie trotzdem zum Zankapfel wurde, lag vor allem am „Vater der Germanistik“, Jacob Grimm. Er fand die Orthographie seiner Zeit „unrichtig, barbarisch und schimpflich“: Durchdrungen von den Ideen der Romantik, war Grimm überzeugt davon, dass die deutsche Sprache im Mittelhochdeutschen ihren Zenit erreicht hatte und sich seitdem auf dem Abstieg befand. Um ihn aufzuhalten und aus dem Geist der restaurierten Sprache die ersehnte deutsche Einheit erstehen zu lassen, entwarf er eine Orthographie, die nicht nur die Substantive klein machte, sondern die Wörter wieder klingen und aussehen ließ wie in den Zeiten Walthers von der Vogelweide: Mond, Licht oder Ereignis sollten künftig wieder mand, liecht und eräugnis heißen. Die Forderung, Löffel durch leffel zu ersetzen, trug Grimms Anhängern den Spottnamen „Leffel-Partei“ ein. Diese „historische Orthographie“ fand viele Verfechter unter den Germanisten. Deutschlehrer experimentierten mit ihr, sie sorgte für Konfusion in den Klassenzimmern und behinderte über viele Jahre die Rechtschreibentwicklung, die eigentlich auf gutem Wege gewesen war. Erst durch die Irritationen, die von der „Leffel-Partei“ in der Lehrerschaft gestiftet wurde, geriet die Schule überhaupt in den Fokus der Orthographie-Diskussionen. Von nun an wurde die leichte Erlernbarkeit und nicht die Leistungsfähigkeit des Schriftsystems zum Maßstab. Gegen Grimms „aristokratische Geheimwissenschaft“ formierte sich die phonetische Richtung, deren Ziel eine möglichst lautgetreue und zugleich gegenwartsorientierte Schreibweise war. Der Konflikt zwischen den Fraktionen bestimmte auf Jahrzehnte hinaus die Rechtschreib-Szene. Um die Schwankungsfälle, die es gab - wie allmählich und allmählig, deshalb und deßhalb oder Fluth und Flut -, zu bereinigen, hätte es eines solchen Grundsatzstreits nicht bedurft. Ebender aber unterminierte jetzt die bereits gewonnene Ordnung, ließ überwundene Unsicherheiten neu entstehen und schuf somit erst die Notwendigkeit einer amtlichen Regulierung. Nach und nach gewannen die Phonetiker über die „Grimmschen“ die Oberhand. Ihre Ideen entsprachen dem wissenschaftlichen Zeitgeist. Phonetik und Lautphysiologie nahmen in diesen Jahren großen Aufschwung. Sprache bedeutete nun vor allem gesprochene Sprache, während der Eigencharakter des Schriftsystems aus dem Blick geriet. Zum Vordenker einer so inspirierten Orthographiereform wurde der Erlanger Germanistik-Professor Rudolf von Raumer, der bei Jacob Grimm studiert hatte. Für ihn wie für alle Kombattanten im Schriftstreit war die Regelung der Orthographie nicht nur eine schulische Angelegenheit, sondern auch ein Baustein der nationalen Einheit. Noch wichtiger als eine reformierte war Raumer deshalb eine einheitliche Rechtschreibung, die von der Bevölkerung im gesamten Sprachgebiet akzeptiert wurde. Dafür war er bereit, seine phonetischen Ideale zurückzustellen und an die tradierte Schreibweise anzuknüpfen. Gibt es öffentlichen Verstand? Diese ausgleichende Haltung, die darauf abzielte, zunächst nur variierende Schreibungen zu regulieren und den Einfluss der historischen Schule zurückzudrängen, verschaffte ihm die Sympathien der Kultusbehörden und vieler Lehrer, die nach einem Ausweg aus der festgefahrenen Orthographie-Debatte suchten. Bald nach der Gründung des Deutschen Reiches bekam Raumer den Auftrag, eine einheitliche Schulorthographie für ganz Deutschland zu entwerfen. Hier und dort verfassten Lehrer schon einmal auf eigene Faust Regeln, unter ihnen Konrad Duden, Gymnasialdirektor im thüringischen Schleiz, dessen Arbeiten die größte öffentliche Beachtung fanden. All diese Orthographien im Eigenbau gründeten auf Raumers Konzepten. Duden schloss sich, obwohl er die her-kömmliche Rechtschreibung als schlimmsten Hemmschuh unserer Volksbildung verdammte, auch Raumers Realpolitik der kleinen Schritte an. So verzichtete er auf die Substantiv-Kleinschreibung und war bereit, das Stammprinzip - man schreibt Kind, obwohl man Kint sagt - als Lesehilfe zu tolerieren, bis irgendwann das phonetische Prinzip sich endgültig durchgesetzt haben würde. Für den Karrierepädagogen war das Klassenzimmer der Transmissionsriemen der Reform, „weil wir niemals durch die Literatur, sondern nur durch die Schule zu einer einfacheren Rechtschreibung gelangen werden“. Als 1876 auf Initiative des preußischen Kultusministers Adalbert Falk eine Konferenz in Berlin zusammentrat, um einheitliche Schreibregeln für ganz Deutschland aufzustellen, war Duden bereits prominent genug, um neben Raumer zum Kreis der vierzehn Teilnehmer zu gehören, der sich aus Germanisten, Lehrern, Kultusbeamten und Vertretern der Druckerei- und Buchhändlerbranche zusammensetzte. Alle Eingeladenen akzeptierten Raumers gemäßigte Linie wenigstens als Diskussionsgrundlage. Grimm-Anhänger blieben ebenso ausgeschlossen wie allzu radikale Fonetiker. Nur zwei Konferenzteilnehmer gehörten nicht zu Raumers Parteigängern: der Germanist Wilhelm Scherer und der Privatgelehrte Daniel Sanders aus dem mecklenburgischen Neustrelitz, ein erfolgreicher Lexikograph, dessen Name heute noch im englisch-deutschen Wörterbuch „Muret-Sanders“ fortlebt. Diese beiden Traditionalisten wollten die überlieferte Rechtschreibung im Wesentlichen unangetastet lassen, standen aber einer vorsichtigen Standardisierung wohlwollend gegenüber. Zunächst beschränkten sich die Konferenzteilnehmer auch programmgemäß darauf, variierende Schreibweisen zu vereinheitlichen. Statt Thau sollte es künftig Tau heißen, gibt statt giebt, Klasse statt Classe oder tot statt todt. Derartige Vorschläge waren unspektakulär, eine schnelle Einigung lag in greifbarer Nähe. Zum Eklat kam es, als die phonetisch orientierte Reformer-Mehrheit unerwartet die Abschaffung der Dehnungszeichen auf die Tagesordnung setzte, um Schreibungen wie Har, Son, Hun, faren oder wülen einzuführen. Nur bei gleichlautenden Wörtern (mahlen/malen) sollten Dehnungskennzeichnungen bleiben, ebenso bei i und e (Lehrer, ihn). Duden gingen die Vorschläge nicht weit genug. Er plädierte auch für Mel, nemen oder stilt. Sanders und Scherer spotteten über die orthographischen Jakobiner, die die „Guillotine niederfahren“ und „die Dehnungszeichen in den Staub rollen“ ließen. Die Konferenz endete im Fiasko, ihre Vorschläge, auch die maßvollen, fielen durch. Auf der Website des Duden-Verlages kann man heute lesen, Bismarcks Veto sei der Grund des Scheiterns gewesen, doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Zwar war der Reichskanzler ein grimmiger Feind aller orthographischen Veränderungen, aber es waren der preußische Kultusminister und seine Kollegen aus den anderen deutschen Bundesstaaten, die, verschreckt von Schreibweisen wie Lon und Sal, das Regelwerk in Bausch und Bogen ablehnten. Sie fürchteten eine Abspaltung der Schulorthographie von der Schreibweise der Verlage und der Mehrheit der Bevölkerung. Auch die Presse reagierte mit Empörung, die von Scherer und Sanders durch gezielt gestreute Informationen und eigene Beiträge noch zusätzlich angestachelt wurde. Für die Reformer, die sich damals wie heute als Fackelträger der Vernunft sahen, steckte dahinter nichts als Demagogie und dumpfer Konservatismus. Doch für Sanders gehörte die Beteiligung der Medien und der Öffentlichkeit - der Duden das Urteilsvermögen absprach - zum Prinzip einer wirklich demokratischen Rechtschreibung. Das Ende der Optimierung Dudens lautgetreue Regeln fand Sanders täppisch und roh. Demokratisch war für ihn die gewachsene Schreibung als Spiegel des allgemeinen Sprachbewusstseins mit all seinen Nuancen. Er betrachtete die Schriftsteller und Journalisten, die Profis der Schriftsprache, als wichtige Stimmen in der Orthographie-Debatte. Dass sie nicht zur Konferenz eingeladen wurden, dass überhaupt keine öffentliche Diskussion stattfand und stattdessen Schulmeister die neue Orthographie hinter verschlossenen Türen diktieren wollten, kritisierte er scharf. Das Etikett des Rechtsaußen, das Duden und andere Reformer ihm nach der gescheiterten Konferenz anhefteten, widersprach dem Selbstverständnis des Revolutionärs von 1848, der seine Stelle als Direktor einer jüdischen Schule wegen demokratischer Umtriebe verloren hatte. Zwar war die Reform havariert, doch Raumers moderate Prinzipien, die auf der Konferenz ursprünglich zur Diskussion gestanden hatten, setzten sich während der folgenden Jahre in den einzelnen deutschen Bundesstaaten trotzdem durch. Raumer selbst starb bald nach der Konferenz. Die Rolle des Cheftheoretikers übernahm jetzt der Germanist Wilhelm Wilmanns, dem sein Freund Konrad Duden, inzwischen Schuldirektor im preußischen Hersfeld, als tatkräftiger Praktiker zur Seite stand. Duden verzichtete auf weitere „Optimierungsversuche“ im phonetischen Geist und konzentrierte sich stattdessen auf sein zweites großes Ziel, die Vereinheitlichung der Rechtschreibung. Aufbauend auf seiner Schulorthographie, brachte er 1880 das „Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache“ mit 187 Seiten und rund 28 000 Stichwörtern heraus. Dieser Urduden, der von Auflage zu Auflage erweitert wurde, erwies sich als Erfolgsmodell. Schon 1887 waren 220 000 Exemplare verkauft. Im Juni 1901, ein Vierteljahrhundert nach dem ersten, gescheiterten Versuch, fand in Berlin auf Einladung des Reichskanzlers Fürst Bernhard von Bülow wieder eine Konferenz mit dem Ziel einer gesamtdeutschen Orthographie statt. Man wollte keine fachlichen Diskussionen mehr, sondern schnelle Beschlüsse. Vorbereitet von Duden und Wilmanns, schrieb die Konferenz im Großen und Ganzen nur noch die Regeln fest, die in den Schulorthographien der Bundesstaaten, der Schweiz und Österreichs faktisch schon galten. Was hier beschlossen wurde, war die Grundlage der bis 1996 gültigen Rechtschreibung. Die Vereinheitlichung war gelungen, aber die von den Reformern gewünschte Vereinfachung blieb weitgehend auf der Strecke. Duden fand, „daß die so entstandene ,deutsche Rechtschreibung' weit davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein“. Ein solches zu schaffen, versuchten während des folgenden Jahrhunderts immer neue Reformergenerationen vergeblich. Was Duden und andere Reformer bewusst herunterspielten, war, dass die Schrift sich gegenüber dem gesprochenen Wort schon längst emanzipiert hatte. Seit dem Mittelalter - als Texte grundsätzlich laut gelesen wurden - hatte sie sich vom reinen Laut-Code für das Ohr zu einem differenzierten System für das Auge entwickelt, das dem Leser durch grammatische und semantische Zusatzinformationen die Sinnzusammenhänge verdeutlicht. Viele scheinbar unlogische Regeln erleichtern die visuelle Verarbeitung, weil sie das Schriftbild stabil und ausgewogen halten und die silbische Gliederung der Wörter verdeutlichen. Da die meisten Menschen bedeutend mehr lesen als schreiben, hat sich diese Leselastigkeit der Orthographie immer mehr verstärkt. Der Preis dafür besteht in den Mühen des Schreibenlernens. Wolfgang Krischke |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 14.08.2011 um 10.20 Uhr |
| Weiß man beiläufig, wann die heutige "f"-Schreibung für Wörter, die im Niederdeutschen und heute noch im Niederländischen mit "v" geschrieben werden, festgelegt wurde? Im Mittelhochdeutschen geht es noch wild durcheinander, siehe "Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch" von Beate Hennig. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 29.01.2013 um 08.28 Uhr |
| Der Artikel von Wolfgang Krischke deckt ein weiteres ungelöstes Problem der Neuregelung auf, denn er schreibt die „Grimmschen“. Ist das iSdNR richtig? § 62 behandelt adjektivische Ableitungen von Eigennamen, schweigt aber zu Substantivierungen dieser Adjektive, und § 57 (1) enthält kein entsprechendes Beispiel. Wenn man nun eine Regelkombination § 62 –> § 57 (1) annimmt, ergäbe sich folgendes Bild: "grimmsche/Grimm'sche Schriften", aber "die Grimmschen". Außerdem kann man "Grimmsches Wörterbuch" und "Grimmsche Märchen" entweder als "Eigennamen von Objekten unterschiedlicher Klassen" nach § 60 (3) oder als "inoffizielle Eigennamen" nach § 60 (5) auffassen. Daß Personennamen nicht in den Unterpunkten zu § 60 (3) genannt werden, spielt keine Rolle, denn die Nennung dieser Unterpunkte setzt mit "so" an, was auch als "z.B." gelesen kann oder sogar muß. Man kann aber nach § 62 auch "grimmsches/Grimm'sches Wörterbuch" und "grimmsche/Grimm'sche Märchen" schreiben. Irre, nicht wahr? Oder irre ich mich? |
| Als Schutz gegen automatisch erzeugte Einträge ist die Kommentareingabe auf dieser Seite nicht möglich. Gehen Sie bitte statt dessen auf folgende Seite: |
| www.sprachforschung.org/index.php?show=newsC&id=349#kommentareingabe |
| Kopieren Sie dazu bitte diese Angabe in das Adressenfeld Ihres Browsers. (Daß Sie diese Adresse von Hand kopieren müssen, ist ein wichtiger Teil des Spamschutzes.) |
| Statt dessen können Sie auch hier klicken und die Angabe bei „news“ von Hand im Adressenfeld ändern. |
