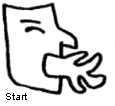
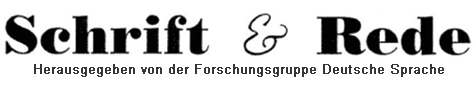

| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
08.06.2013
Ökonomie der Sprache?
Zur Motivation der artikulatorischen Anstrengung des Sprechers
Ist der Sprecher wirklich nur daran interessiert, es sich möglichst einfach zu machen?
Strukturalistische Erklärungen des Sprachwandels berufen sich oft auf ein Prinzip, das ungefähr so lautet: Der Sprecher möchte es sich möglichst bequem machen, am deutlichsten bei der Artikulation. Daher die vielen Auslassungen usw., die dann auch zum Sprachwandel führen – "Économie des changements phonétiques", wie der Titel eines berühmten Werkes von André Martinet schon andeutet. Die "Natürlichkeitstheorie" hat daraus zunächst die Tendenz zur idealen Silbe gemacht (Konsonant + Vokal).
In den letzten Jahren ist viel darüber geschrieben worden, daß diese Tendenz in Sprachen wie dem Deutschen geradezu auf den Kopf gestellt zu sein scheint (schrumpfst), und man hat dann typologisch Silbensprachen (wie Italienisch) und Wortsprachen (wie Deutsch) unterschieden. Damit ging die Behauptung einher, Silbensprachen seien leicht für den Sprecher und schwer für den Hörer (der die Lexeme um so schwerer heraushören kann, je mehr einfache Silben, durch Liaison verbundene und gleichmäßig akzentuiert, aneinandergereiht werden). Hierzu Einzelheiten vor allem in den Schriften von Damaris Nübling und Renata Szczepaniak. Der Gedanke, daß die Anstrengung des Sprechers und die des Hörers sich umgekehrt reziprok verhalten, ist aber schon früher oft ausgesprochen worden, z. B. von Gerhard Ernst in Holtus/Radtke, Hg.: Varietätenlinguistik des Italienischen. Tübingen 1983:114.
Wir kennen eine entsprechende Diskussion in bezug auf die Rechtschreibung. Nerius und andere haben immer wieder die Gegensätzlichkeit von Schreiber- und Leserinteresse betont, das ist die Grundlage ihrer Reformideen. Und unsere Antwort war immer: Die Schrift ist nicht zum Schreiben da.
Mein Einwand also: Wenn der Sprecher so maulfaul ist – warum macht er überhaupt den Mund auf? Man kann ja nicht behaupten, daß er das Sprechen zum Überleben braucht. Wozu reden denn die Menschen ununterbrochen miteinander? Vieles davon ist doch lustvolle Selbstdarstellung, und dabei erweist man sich keineswegs als besonders sparsam.
Nur wenn schon klar ist, was ich sagen oder schreiben will, kann es mir gar nicht schnell genug gehen und kürze ich ab, verschleife usw. Die Logorrhöe des Alltags kann man so nicht erklären.
Wenn der junge Pianist übt, hudelt er vielleicht über das Stück hin, aber wenn er es wirklich einem Publikum vorführt, gibt er sich mit den kleinsten Einzelheiten die größte Mühe.
Kurzum: Das Prinzip des kleinsten Kraftaufwandes ist vielleicht nicht so selbstverständlich und muß ergänzt werden.
| Kommentare zu »Ökonomie der Sprache?« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 13.05.2024 um 12.34 Uhr |
|
Man denkt erstmal an einen Sketch, aber die Geschichte ist wahr. Die rote Karte des Schiedsrichters könnte man ja noch als Affekthandlung bzw. Mißverständnis entschuldigen, aber daß der DFB danach die fällige Mindestsperre von einem Spiel auf 14 Tage verlängert hat, zeugt von echter Humorlosigkeit.
|
Kommentar von Tante Google, verfaßt am 12.05.2024 um 16.49 Uhr |
|
Schiedsrichter: "Herr Lippens, ich verwarne Ihnen" Willi "Ente" Lippens: "Herr Schiedsrichter, ich danke Sie" Schiedsrichter: Rote Karte |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 09.05.2024 um 22.00 Uhr |
|
André Rieu ruft seinem Publikum zigmal während jeder Veranstaltung zu: "Geben Sie sie einen Riesenapplaus!", gleichermaßen für die Einzahl, weiblich (ihr) wie für die Mehrzahl (ihnen). [Im Falle der Einzahl, männlich jedoch korrekt (ihm).] Es kann wohl kaum sein, daß er nach so vielen Jahren nicht weiß, wie es richtig heißt oder daß ihn noch nie jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Also sagt er es absichtlich so, d.h. er kokettiert mit seiner niederländisch gefärbten Aussprache und Grammatik? Es klingt ja nicht unsympathisch. Oder ist es seine eigene ganz persönliche Art von Sprachökonomie? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.02.2024 um 04.26 Uhr |
|
Zum vorigen: Manchmal stoße ich auf Versuche, die Ökonomie des Verhaltens auf einen Knappheitsbegriff zu gründen, der ungefähr so geht: Statt sich den Aufwand des Balzverhaltens zu leisten, könnte das Männchen doch Zeit und Energie auf die Futtersuche verwenden. Ist das schlüssig? Man kann doch nicht immer nur fressen. Ich gehe gern auf solche vielleicht banalen Fragen zurück, um nicht in einen bekannten Fehler zu verfallen. Alan Grafens mathematischer Beweis, daß Zahavis Handcap-Theorie möglich ist, wurde weithin als Beweis dieser Theorie mißverstanden, vor allem weil fast niemand die eindrucksvolle Mathematik verstand. Penn und Számadó klären das auf (womit ich mir natürlich kein abschließendes Urteil in der Sache selbst erlaube). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2024 um 17.23 Uhr |
|
Ich komme im Zusammenhang mit Zahavi noch einmal auf das Thema zurück. Martinet erkennt das Problem, daß die Ersparnis von „geistiger (?) und körperlicher Energie“ in einem gewissen Widerspruch zu spielerischer Sprachtätigkeit steht, und sieht einen Ausweg darin, daß das Spiel ja auch Regeln befolgen muß, um Freude zu machen. (Grundzüge der allgemeinen Sprachwissenschaft. Stuttgart 1963:164ff.) Es werde immer ein Gleichgewicht hergestellt zwischen der Trägheit und dem Ausdrucksbedürfnis – aber das ist tautologisch und aus dem Postulat heraus nachträglich konstruiert. Zwar haben wir bei Müdigkeit (ebd.) Schwierigkeiten, uns deutlich auszudrücken, aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß vollkommene Ruhe nicht erstrebenswert ist und z. B. der ganze Sport eine Energieverschwendung ist; Gesundheitsgründe spielen sicher keine große Rolle. Wenn ich morgens einige Stunden am PC gesessen habe, dann will ich raus und zwei Stunden durch Mittelfranken laufen. Leben heißt eben auch Bewegung, „Funktionslust“, und Ruhe kann eine besondere Anstrengung erfordern. Niemand strengt sich mehr an als der Leistungssportler, der Bergsteiger – aber es dürfte schwer fallen, ihm ein Bedürfnis zu unterstellen, das „den Aufwand lohnt“. Gossip wird in größtem Umfang betrieben, und es mag eine soziale und biologische Funktion haben, aber wird dadurch der Aufwand gerechtfertigt? Martinet beobachtet richtig die Neigung zu Kurzwörtern (Akku, Foto), aber diese Ersparnis tritt nur ein, wenn schon klar ist, was gesagt werden soll. Es ist vielleicht mehr eine Beschleunigung, also eine Zeitersparnis, als eine Einsparung von Kraft oder Energie. Ich bin ungeduldig, wenn du schon weißt, was ich sagen will. „Sprachökonomie wird nicht selten mit André Martinets Gesetz des geringsten Aufwandes (loi du moindre effort) in Verbindung gebracht, ist aber wesentlich älter. Schon William Dwight Whitney verwendet den Ausdruck economy, und auch bei Otto Jespersen taucht der Terminus auf.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Sprach%C3%B6konomie) Viele haben versucht, Kosten und Nutzen in ein Verhältnis zu bringen (Ronneberger-Sibold), aber der Nutzen ist schwer zu berechnen. Das betriebswirtschaftliche Vorbild läßt sich kaum übertragen, weil die Knappheit der Ressourcen bei der Sprache keine rechte Entsprechung hat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.11.2023 um 09.06 Uhr |
|
Mark Changizi et al.: „The Structures of Letters and Symbols throughout Human History Are Selected to Match Those Found in Objects in Natural Scenes“ (https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/502806) Aus der Zusammenfassung: „We provide evidence that the shapes of visual signs are selected to be easily seen at the expense of the motor system.“ Also „Die Schrift ist nicht zum Schreiben da“ (sondern zum Lesen, wie Friedrich Roemheld feststellte). Das war unser erstes Argument gegen den Ansatz der Rechtschreibreformer. Kuriose Bestätigung von unerwarteter Seite. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.01.2023 um 04.40 Uhr |
|
Auch wenn jedes Wachstum und jede Bewegung gewisse „Kosten“ haben (Energieaufwand, der durch Stoffwechsel ermöglich wird), kann man das doch nicht einfach so deuten, als sei die völlige Untätigkeit der Urzustand, auf den alles hinstrebt. Kinder sind unaufhörlich in Bewegung, obwohl oder gerade weil sie niemand dazu zwingt. Als älterer Mensch könnte man geradezu schwindlig werden, wenn man diese Quirligkeit beobachtet. Sie ist gewissermaßen ein Luxus, aber die Evolutionslehre muß ihr einen Überlebenswert zuschreiben. Ob man sie an das Explorationsverhalten mancher Tiere anschließen kann? Ist das Spiel (die „Kultur der Kindheit“ nach Bruner) hier einzuordnen? Vgl. die Spannung zwischen der „Ökonomie“ des Lautwandels (André Martinet) und der scheinbar überschießenden Redelust (Klatsch usw., s. Haupteintrag), die uns als gar nicht maulfaul erweist: Stillsein wäre doch ökonomischer – wozu der Redeschwall, die Rhetorik, die Kalligraphie...? Auch hier die Dominanz des Sozialen, der gesellschaftlichen Bindung, daher der phatischen Kommunikation. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.04.2017 um 04.22 Uhr |
|
"But in examining the laws of style Spencer necessarily speaks of the hearer (recipient) only and says nothing about the speaker (producer). Now I found that in valuation of a language, or a linguistic expression, both sides should be taken into consideration: the best is what with a minimum of effort on the part of the speaker produces a maximum of effect in the hearer." (Otto Jespersen) Die Aufgabe ist mathematisch sinnlos formuliert, und das deutet auf eine tieferliegende Schwierigkeit hin. Um z. B. die phatische Kommunikation (das Reden um des Redens willen) einzubeziehen, mit dem ein Teil der Menschheit den ganzen Tag beschäftigt ist, muß man den Begriff der Wirkung oder des Erfolgs nach Bedarf so weit dehnen, daß er willkürlich wird: es wird sich immer eine Wirkung finden lassen. Was ist mit der Wirkung auf den Sprecher selbst, der „Funktionslust“ am reinen Palaver? Wikipedia definiert: „Man versteht unter Sprachökonomie die Neigung von Sprecher und Hörer, auf Sprachformen so einzuwirken, dass die Kommunikation zwischen beiden gewährleistet ist bei einem für beide möglichst geringen Aufwand.“ Hier wird alles in den Begriff „Kommunikation“ gepackt. Auch läßt sich der geringste Aufwand für Sprecher und Hörer nicht berechnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.03.2016 um 13.03 Uhr |
|
Das Deutsche ist, wie gesagt, eine Wortsprache; diese Einsicht ist aber nicht neu, schon Trubetzkoy hat es 1939 dargelegt: „Es gibt Sprachen, die nicht nur sehr wenig Grenzsignale besitzen, sondern sie auch sehr selten verwenden. […] Zu solchen Sprachen gehört z.B. das Französische, das auf das Abgrenzen der Wörter (bzw. Morpheme) im Satze sehr wenig Wert legt. Andere Sprachen weisen umgekehrt eine übertriebene Vorliebe für Grenzsignale auf, indem sie außer der gebundenen Betonung, die alle Wortgrenzen kennzeichnet, noch eine Fülle anderer Grenzsignale verwenden […]. Das Deutsche gehört auch zu den ‚abgrenzungsliebenden’ Sprachen.“ Der ästhetische Eindruck des Deutschen im Vergleich zu Sprachen mit Liaison (und im wesentlichen Silben aus Konsonant plus Vokal) hat hier seine Ursache. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.08.2015 um 15.32 Uhr |
|
Stimmt schon irgendwie, aber das betrifft eine ganze Menge langer Wörter, für die man auch nicht so leicht Alternativen findet. Ich denke, als Deutschsprechender ist man daran einigermaßen gewöhnt, so daß der Änderungsdruck nicht allzu groß ist. In dieser Hinsicht gleich wie verunsichernder sind z. B. - abwandernder - einschläfernder - schlafwandelnder usw. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.08.2015 um 10.54 Uhr |
|
Ich lese zufällig ein verunsichernder Schmerz. Mir ist das Partizip physisch unangenehm, noch ein wenig anders als der schon besprochene Komparativ sicherere. Die Mehrfachkonsonanz zwei Silben nach dem Hauptakzent ist einfach zu viel. Empfinden Sie das auch so? Sprachwandel besteht ja nicht zuletzt in der Vereinfachung solcher unbequemer Lautfolgen.
|