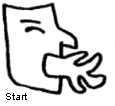


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
17.06.2014
Blaupause oder Rezept
Zu einem Grundgedanken von Richard Dawkins
Wie wird das Wachstum eines Lebewesens von den Genen gesteuert? Wie wird das Verhalten eines Organismus vom Nervensystem gesteuert?
Diese beiden Fragen werfen ein Problem auf, das strukturell identisch ist, auch wenn die stoffliche Verwirklichung sehr verschieden ist. Dawkins hat sich nur mit dem genetischen Aspekt beschäftigt, Lashley hat in seiner bekanntesten Arbeit die neurophysiologische Seite analysiert. (Karl S. Lashley: „The problem of serial order in behavior“. In L.A. Jeffress, Hg.: Cerebral mechanisms in behavior. New York 1951)
Man nimmt an, daß in beiden Fällen ein „Bauplan“ zugrunde liegt. Lange Zeit dachte man, daß dieser Plan eine Art maßstäbliche Abbildung oder „Repräsentation“ des fertigen Lebewesens sein müsse. Im Falle der Verhaltenssteuerung sollte der Plan (z. B. die Struktur eines Satzes) als statische Konstellation existieren, die dann abgelesen („gescannt“) und in Verhaltensimpulse umgesetzt wird. Man hat Lashley vorgehalten, daß es zur Art des Scanning-Mechanismus nicht die geringsten Anhaltspunkte gibt, insbesondere was die scannende Instanz betrifft, und Lashley hat seine Ratlosigkeit selbst eingestanden:
„The real problem, however, is the nature of the selective mechanism by which the particular acts are picked out in this scanning process and to this problem I have no answer.“
Dawkins hat in vielen Schriften einen Vergleich angestellt, der eine Alternative eröffnet:
„DNA is commonly referred to in textbooks of molecular biology as the 'blueprint' for an organism. I would rather call it a recipe or like a computer program.
The difference between a blueprint and a recipe is that a blueprint is reversable, and a recipe is not. If you have a house and you have lost the blueprint you can reconstruct the blueprint by taking measurements, but if you have got a well prepared dish in a great restaurant you may enjoy the dish and you may dissect it and look at it in every detail but you cannot reconstruct the recipe.“
Wenn man einen Kuchen backt, mischt man die Hefe mit weiteren Zutaten, dann läßt man den Teig eine halbe Stunde aufgehen. Dabei geschieht etwas, was in keiner Weise im Rezept enthalten, aber doch die Voraussetzung für die Wirksamkeit der nächsten Vorschrift ist. So verteilen sich etwa die Rosinen in einer Weise, die nicht vom Rezept allein gesteuert ist, sondern von der Physik und Chemie der Zutaten und der Umgebung. Die Entstehung des Kuchens ist also nicht vollständig im Rezept enthalten. So auch beim Verhalten eines Organismus in seiner Umwelt. Weder was der Mensch tut, noch was am Ende dabei entsteht, ist vorweg als Abbild oder Blaupause in ihm vorhanden, daher ist es auch nicht nötig, ein mentales Lexikon anzunehmen, um den scheinbaren „Abruf“ der Wörter zu erklären. Der Pianist, der zehn verschiedene Klavierabende geben kann, ohne je in die Noten zu sehen, hat nicht die Partituren im Kopf. (Was ohnehin wieder das ungelöste Problem aufwerfen würde, wer diese Partituren dort eigentlich liest oder „scannt“.)
Wie auch immer solche Prozesses in Wirklichkeit ablaufen, es ist jedenfalls klar, daß die Annahme von „Repräsentationen“ nicht notwendig ist. Damit erledigt sich auch die Rede vom „Speichern“. Der Kuchen ist nicht im Rezept seiner Herstellung „gespeichert“. Man könnte auch an die Kreisformel denken, die den Kreis nicht „repräsentiert“.
Hier sind, als Anhang, noch weitere Formulierungen von Dawkins:
„Ein Rezept in einem Kochbuch ist in keiner Weise eine Blaupause des Kuchens, der schließlich aus dem Ofen kommen wird. Nicht etwa deshalb, weil das Rezept ein eindimensionaler Strang von Worten ist, der Kuchen jedoch dreidimensional.
Wie wir gesehen haben, ist es ohne weiteres möglich, ein maßstabsgerechtes Modell durch ein Rasterverfahren in einen eindimensionalen Code umzuformen. Aber ein Rezept ist kein maßstabsgerechtes Modell, keine Beschreibung eines fertigen Kuchens, auf keinen Fall eine Punkt-für-Punkt-Darstellung. Es ist ein Satz von Instruktionen, die, in der richtigen Reihenfolge ausgeführt, einen Kuchen hervorbringen werden. Ein echter eindimensional kodierter Plan eines Kuchens bestünde aus einer Serie von Rastern durch den Kuchen, als hätte man mit einem Fleischspieß systematisch durch die Ebenen des Kuchens gebohrt. In Millimeterintervallen würde die unmittelbare Umgebung der Spitze des Fleischspießes im Code festgehalten; b eispielsweise würden die Daten die genauen Koordinaten jeder Rosine und jeder Krume enthalten. Das gäbe eine strikte Eins-zu-eins-Beziehung zwischen jedem Teilchen des Kuchens und dem korrespondierenden Teilchen der Blaupause. Das ist eindeutig etwas ganz anderes als ein wirkliches Rezept. Es gibt keine Eins-zu-eins-Aufzeichnung zwischen den Kuchenkrümeln und den Wörtern oder Buchstaben des Rezepts. Die Worte des Rezepts bezeichnen nicht einzelne Stückchen fertigen Kuchens, sondern einzelne Schritte auf dem Wege der Herstellung eines Kuchens.“ (Der blinde Uhrmacher. München (dtv), S. 426)
—
The central dogma of embryology does not follow inevitably from common sense. Rather, it is a logical implication of rejecting the preformationist view of development. I suggest, indeed, that there is a close link between the epigenetic view of development and the Darwinian view of adaptation, and between preformationism and the Lamarckian view of adaptation. You may believe in inheritance of Lamarckian (i.e. “instructive”) adaptations, but only if you are prepared to embrace a preformationistic view of embryology. If development were preformationistic, if DNA really were a “blueprint for a body”, really were a codified homunculus, reverse development — looking-glass embryology — would be conceivable.
But the blueprint metaphor of the textbooks is dreadfully misleading, for it implies a one-to-one mapping between bits of body and bits of genome. By inspecting a house, we may reconstruct a blueprint from which somebody else could build an identical house, using the same building technique as was used for the original house. The informational arrows from blueprint to house are reversible. The relative positions of the ink lines in the blueprint and of the brick walls in the house are transformable, one into the other, by a few simple scaling rules. To go from blueprint to house, you multiply all measurements by, say twenty. To go from house to blueprint, you divide all measurements by twenty. If the house somehow acquires a new feature, say a west wing, a simple, automatic procedure could be written down for adding a scaled-down map of the west wing to the blueprint. If the genome were a blueprint with a one-to-one mapping from genotype to phenotype, it would not be inconceivable that the white imprint of a hand on an otherwise tanned chest could be mapped on to a sort of miniature genetic shadow of itself, and so inherited.
But this is utterly alien to everything we now understand about the way development works. The genome is not, in any sense whatsoever, a scale model of the body. It is a set of instructions which, if faithfully obeyed in the right order and under the right conditions, will result in a body. I have previously used the metaphor of a cake (Dawkins in press a). When you make a cake you may, in some sense, say that you are “translating” from recipe to cake. But it is an irreversible process. You cannot dissect a cake and thereby reconstruct the original recipe. There is no one-to-one, reversible mapping from words of recipe to crumbs of cake. This is not to say that a skilled cook could not achieve a passable reversal, by taking a cake presented to him and matching its taste and properties against his own past experience of cakes and recipes, and then reconstructing the recipe. But that would be a kind of mental selection procedure, and would in no sense be a translation from cake to recipe (a good discussion of the difference between reversible and irreversible codes, in the context of the nervous system, is given by Barlow 1961).
A cake is the consequence of the obeying of a series of instructions, when to mix the various ingredients, when to apply heat, etc. It is not true that the cake is those instructions rendered into another coding medium. It is not like a translation of the recipe from French into English, which is in principle reversible (give or take a few nuances). A body, too, is the consequence of the obeying of a series of instructions; not so much when to apply heat as when to apply enzymes speeding up particular chemical reactions. If the process of embryonic development is correctly set in motion in the right environment, the end result will be a well-formed adult body, many of whose attributes will be interpretable as consequences of its genes. But you cannot reconstruct an individual's genome by inspecting his body, any more than you could reconstruct William Shakespeare by decoding his collected works. Cannon's and Gould's false argument of p. 116 is validly adapted to embryology. (Richard Dawkins: The Extended Phenotype. Oxford, New York 1999:174f.)
| Kommentare zu »Blaupause oder Rezept« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.06.2024 um 05.33 Uhr |
|
Je mehr man sich mit der Neurophysiologie des Sehens beschäftigt, desto mehr zerfällt die naive Auffassung, die ja eher an Kameras orientiert ist. Man erfährt von getrennten Detektoren für Linien verschiedener Orientierung, für Ecken und Bewegungen; hinzu kommen Mechanismen wie das Barlowsche efficient coding usw. Am Ende kommt es nur auf zweckdienliche Reaktionen an, und dazu gehört auch die Auskunft, die wir über unsere Eindrücke oder „Erlebnisse“ geben. Sie sind voller Illusionen. Wir berichten nicht, was wir extrafoveal wirklich sehen, sondern was wir wissen; wir übersehen den blinden Fleck, leugnen die schlechte Farbwahrnehmung gegen die Peripherie hin, ergänzen die Daten durch Zutaten, die man in der Gestaltpsychologie erforscht hat; wir „übersehen“ die kurze Verdunkelung durch den Lidschlag, kompensieren stürzende Linien, schärfen Konturen, nutzen verschiedene Konstanzleistungen usw. – alles, um angemessene Reaktionen zu ermöglichen. Aus naiver Sicht glauben wir, die verschiedenen Merkmale müßten zu einem erlebten Gesamtbild „gebunden“ werden. Das ist aber selbst nur eine Illusion. Die Bindung, die von der Bindungstheorie gefordert wird, findet nicht im Geist und nicht im Gehirn statt, sondern in der einheitlichen Reaktion auf die verschiedenen Reize. Die allseits beliebte Computeranalogie müßte das eigentlich plausibler machen. Beim Computer resultiert die Bewegung eines Roboterarms, ein Bild auf dem Monitor usw., ganz gleich, woher die Komponenten im Innern der Maschine kommen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.03.2024 um 23.39 Uhr |
|
nochmal zu ChatGPT: Frage: In der Ebene E liegt das gleichseitige Dreieck ABC mit den Eckpunkten A, B und C. Wie viele Geraden der Ebene E schneiden sich im Punkt A? ChatGPT: Da der Punkt A ein Eckpunkt des gleichseitigen Dreiecks ABC ist, treffen sich alle Seiten des Dreiecks an diesem Punkt. Daher schneiden sich alle Geraden, die eine Seite des Dreiecks schneiden, auch im Punkt A. Ein gleichseitiges Dreieck hat drei Seiten, also schneiden sich insgesamt drei Geraden im Punkt A. Jeder Satz in der Antwort ist unglaublicher Unsinn. Solange man solche Antworten bekommt, kann man kaum von Intelligenz reden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.04.2023 um 20.31 Uhr |
|
Noch einmal zu Gedächtnis und Speicherung: Heute fiel mir ein, daß der einstige Landesbischof Wurm, der gerade in einem Text erwähnt wurde, mit Vornamen Theophil hieß. Wie ist diese für mich völlig gleichgültige „Information gespeichert“? Ich habe bestimmt jahrzehntelang nicht daran gedacht. Es dürfte in meinem Gehirn auch so wenig ein Theophil-Wurm-Neuron geben wie jenes legendäre Großmutterneuron. Das würde auch nicht lange überleben. Der Name muß also aus einer großen synaptischen Matrix generiert werden. Aber es ist völlig unbekannt, wie das vor sich geht. Bei Namen und anderen Wörtern mag die Standardisierung der Form erst im Augenblick des Erinnerns erzeugt werden, vgl. Dawkins über Origami und Stille Post. Die Erinnerung an eine Landschaft usw. ist nachweislich viel unbestimmter, als es uns scheint, und es gibt keine Handhabe, ihre Konturen zu schärfen. Aber wenn mir zum Kirchenmann Wurm vielleicht eine diffuse Klangwolke einfällt, die entfernt so ähnlich wie Theophil klingt, dann wird dieses vage Phantom augenblicklich auf die diskrete phonologische Form „Theophil“ gebracht und dann auch so ausgesprochen, innerlich oder äußerlich. Anders gesagt: Sprachlichen Fragmenten wird „aus Bordmitteln“ (aus der Sprachbeherrschung) eine scharfe Kontur verpaßt. Man kann sich irren – wie bei der Stillen Post etwas anderes herauskommen kann, als hineingegeben wurde –, aber es wird stets die phonologische Bestimmtheit wirklicher Wörter haben und nicht ein degeneriertes Gebrabbel oder Gezwitscher sein, das nicht als Sprache zu erkennen ist. „Gespeichert“ muß aber nicht das ganze Wort mit aller seiner Durchgeformtheit sein. (Zur „Ökonomie“ vgl. die „efficient coding hypothesis“. Man denkt auch an komprimierte Dateien...also um Redundanz bereinigte.) |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 14.03.2023 um 22.40 Uhr |
|
Den hätte ich ohne Erklärung nicht verstanden: https://pbs.twimg.com/media/FrNKfcdaMAA2jGw.jpg |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 14.03.2023 um 21.52 Uhr |
|
KI kann Witze erklären. Unten das Bild: https://threadreaderapp.com/thread/1635694046566920195.html The humor in this image comes from the absurdity of plugging a large, outdated VGA connector into a small, modern smartphone charging port. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 20.02.2023 um 03.52 Uhr |
|
Bings Chatbot wehrt sich gegen Bedrohung mit Gegendrohung. https://twitter.com/tobyordoxford/status/1627414519784910849 |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 02.02.2023 um 17.28 Uhr |
|
Man sollte der KI ordentlichen Unterricht gönnen, statt sie mit Millionen von Texten zu malträtieren. Jeder Mensch würde einen Nervenzusammenbruch erleiden. Die Zeit ist noch nicht reif für künstliche Intelligenz. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 02.02.2023 um 16.46 Uhr |
|
Inzwischen gibt es einen zweiten Teil vom gleichen Autor mit einfachen, originellen Logikaufgaben (auch schön zum selber knobeln). Wenn man ChatGPT auf diese Weise auf die Probe stellt, werden natürlich logische Schwächen besonders deutlich. Andererseits glaube ich, solange solche Logiktests nicht bestanden werden, kann man sich auch auf allen anderen Gebieten nicht auf einen sinnvollen Output verlassen. Vieles wird vielleicht durch Geschwätzigkeit ein bißchen kaschiert. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 02.02.2023 um 10.24 Uhr |
|
Hab mir das Video jetzt angesehen. Ich finde absolut erstaunlich, was OpenAI leistet. Ganz interessant das Fazit, etwa ab 29:20. Was sagt das Fazit eigentlich über ChatGPT? Oder sagt es nicht eher etwas über das vollzogene Training? Also etwas über Menschen?
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.01.2023 um 12.19 Uhr |
|
Entschuldigung, hier ist der Link: https://m.youtube.com/watch?v=medmEMktMlQ&feature=youtu.be |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 30.01.2023 um 12.12 Uhr |
|
Zum aktuellen Stand und den Schwächen von chatGPT finde ich diesen halbstündigen Vortrag von Edmund Weitz (Hamburger Mathematikprof.) sehr aufschlußreich. Ist auch recht unterhaltsam und amüsant gemacht, lohnt sich!
|
Kommentar von Christof Schardt, verfaßt am 27.01.2023 um 00.51 Uhr |
|
ChatGPT: Es ist wichtig, respektvoll und inklusive Sprache zu verwenden, um ... Seltsam, daß diesem Wunderding, wenn es auch inhaltlich noch nicht perfekt sein mag, solche grammatischen Schnitzer unterlaufen (fehlendes "e"). |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 26.01.2023 um 23.45 Uhr |
|
Chat GPT ist sehr klug. https://pbs.twimg.com/media/FnaxdscWYAALja5.jpg |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.01.2023 um 08.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1616#43752 Ich möchte noch nachtragen, daß weder Barlow noch Attneave ein "Gedankenexperiment" (thought experiment) durchgeführt haben. Sie haben vielmehr die Folgen einer Hypothese berechnet und herausgefunden, daß sie absurd wären, die Hypothese folglich nicht stimmen kann. Eine weitere Bestätigung meiner Annahme, daß es keine Gedankenexperimente gibt. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 17.01.2023 um 07.59 Uhr |
|
Eine Simulation kann sich dem Original vielleicht ausreichend annähern, auch wenn sie grundsätzlich anders funktioniert. Vergeßliche und übermüdete KIs wären auch mal interessant. Was können die Bots uns anhaben? Den Überlebenswillen haben nur wir. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 17.01.2023 um 07.42 Uhr |
|
Gibt es schon Wissenschaftler, die im Inneren von Chatbots mentale Repräsentationen feststellen können?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.01.2023 um 06.26 Uhr |
|
Was Sie zuletzt sagen, entspricht meiner Auffassung, daß Maschinen ohne eine "Geschichte" nicht über das Simulieren hinausgelangen. Die Lerngeschichte, Sozialisation, steht bei uns im Zeichen unserer Sterblichkeit. Ich rede fast wie ein Heideggerianer... Aber ich meine, daß unser Lernen wie uns ganzes Verhalten dazu dient, eine "Not zu wenden", und das ist letztlich die Überlebensstrategie, solange es eben geht. Aber dahinter steckt wiederum das Überleben der Art, der Gene... Nur dadurch kommt die "Intentionalität" in die Welt, also der Wille, die Gefühle, die Erkenntnis (als Anpassung verstanden). Kurze utopische Folgerung: Maschinen müßten "Kinder kriegen" (Replikation), die müßten mehr oder weniger angepaßt sein und entsprechend überleben, um sich ihrerseits zu vermehren oder eben nicht. Sie müßten sich ontogenetisch anpassen (lernen), zur Steckdose laufen, um Strom zu tanken (den andere ihresgleichen irgendwo hergestellt haben) und sich irgendwann auflösen (sterben), um der nächsten Generation Platz machen, denn die Ressourcen sind immer begrenzt. Mit solchen Wesen könnten wir uns dann wirklich unterhalten. Sie würden verstehen, was wir meinen, und nicht nur simulieren. Vielleicht würden sie uns abschaffen, weil wir doch ziemlich veraltet sind. Unsere Augen sind fehlkonstruiert, die Nerven könnten auf anderer Grundlage schneller feuern, solche grotesken Dinge wie den Nervus laryngeus recurrens könnte man vergessen, es gäbe keine Erbkrankheiten... Während wir immer nur Neuraths Schiff auf hoher See umbauen, wären unsere maschinellen Nachfolger from scratch durchkonstruiert. Das wird vermutlich für immer Romanstoff bleiben. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 16.01.2023 um 18.36 Uhr |
|
Man kann den Test dort selbst machen. Vier Antworten der KI, eine von Dennett. Man muß unter den fünf Antworten die "echte" erkennen. Zehn Durchgänge. Interessant ist, daß die Antworten sehr unterschiedlich sind. nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich. Zu Chat GPT: Ich habe damit noch nicht selbst herumgespielt, nur gelesen, was andere so ausprobiert haben. Aber das finde ich durchaus beeindruckend. Chat GPT kann alle möglichen Sachfragen beantworten, Gedichte schreiben, programmieren. Eigentlich müßte man so eine künstliche Intelligenz wie einen Menschen erziehen (natürlich mit dem körperlichen Drumherum). Ansonsten ist ein Vergleich immer unfair. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.01.2023 um 15.35 Uhr |
|
Genau wie bei der automatischen Übersetzung kann man bei der automatischen Erzeugung "neuer" Texte auf die statistische Analyse großer Textcorpora zurückgreifen. Über ChatGPT wird zufällig auch in der heutigen SZ berichtet. Als Chomsky, G. A. Miller und andere die "Neuheit" (Kreativität) sprachlicher Gebilde hervorhoben, antworteten andere (Dwight Bolinger) mit dem Hinweis auf die ungeheure Menge von ganzen und halben Wiederholungen, aus denen wirkliche Texte bestehen. Ich habe den Eintrag bei Schwitzgebel noch nicht ganz gelesen, aber Dennett ist sicher ein guter Griff, weil er seit 50 Jahren immer das gleiche sagt. Anfangs fand ich ihn anregend, aber nach einigen Jahrzehnten wurde es mir langweilig, zumal er auf Kritik kaum reagiert, sondern allenfalls mal eine griffige neue Formulierung einführt ("free-floating rationale"). Vgl. meine Kritik an seiner Übernahme der "Mem"-Theorie. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 16.01.2023 um 08.58 Uhr |
|
Can You Distinguish Daniel Dennett from a Computer? https://schwitzsplinters.blogspot.com/2022/07/results-computerized-philosopher-can.html via https://heise.de/news/Interview-Wie-ChatGPT-die-Lehre-veraendert-7451975.html |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.02.2022 um 05.32 Uhr |
|
Das Sprechen ist in einem ähnlichen Sinn rational, wie das Urmeter in Paris seinerzeit einen Meter lang war, nämlich nicht durch Vergleich mit einem Eichmaß, sondern als dieses selbst. Wir nennen ein Verhalten rational, wenn der Sichverhaltende es mit begleitender Rede begründen und rechtfertigen kann (Rede = lat. ratio). Die Verhaltensanalyse will das Reden als gelernte Fertigkeit verstehen, nicht anders als Fahrradfahren oder Klavierspielen. Skinners „Verbal Behavior“ ist der ausführlichste Entwurf dieses Programms. Dagegen wehren sich die Rationalisten und Geistmetaphysiker (Chomsky usw.) mit Händen und Füßen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.02.2022 um 06.14 Uhr |
|
Dennett versteht sich als besonders konsequenten Darwinisten. Sein zweiter Gewährsmann ist Dawkins, er glaubt aber beide ergänzen zu müssen, um den Evolutionsgedanken zu vollenden und auszuschöpfen. So hat er vor gut 50 Jahren die Lehre vom „intentionalen Standpunkt“ hinzugefügt und aus dem gleichen Geist später die „free-floating rationales“ – beides hat Dawkins nicht übernommen, weil er es als Biologe offensichtlich nicht braucht. Die von Dawkins mehr skizzierte als ausgearbeitete Idee der „Meme“ – quasi-evolutionär überdauernde kulturelle Elemente – haben Dennett und Blackmore bis ins Absurde radikalisiert und dadurch leicht angreifbar gemacht. (Dennett besteht darauf, daß es sich um wirkliche Evolution handelt und nicht um eine Metapher oder eine Analogie.) Dennett und Dawkins stellen gern Fotos eines australischen Termitenhügels und der Sagrada Familia von Gaudí nebeneinander. (Der ausgewählte Termitenbau verdankt seine überraschende Form der Reparatur einer Beschädigung; daher die vielen „Türmchen“, die man sonst bei Termiten-„Hügeln“ nicht findet. Die oberirdischen Teile der Termitenbauten dienen bekanntlich der Klimatisierung der eigentlichen, unterirdischen Behausung.) Für Dennett ist es ein Beispiel für „competence with and without comprehension“. Die oberflächliche Ähnlichkeit der beiden Konstruktionen ist natürlich für das Argument gleichgültig. Dennett hätte auch einen Faustkeil oder eine Dampfmaschine heranziehen können, um die Besonderheit menschlichen Handelns zu veranschaulichen. Die Wahl der Bilder ist nur ein didaktischer Kunstgriff. Das Argument ist jedoch aus mehreren Gründen falsch. Es umschreibt im Grunde nur die unbestreitbare Tatsache, daß der Mensch sprechen kann und die Termiten nicht. Verstehen, Wissen, Bewußtsein sind kein Verhalten und keine beobachtbaren Tatsachen, sondern Konstrukte innerhalb und mit Hilfe der Sprache. Außerhalb der Sprachgemeinschaft mit ihren in langer kultureller Überlieferung entwickelten Verständigungsweisen haben sie keinen Platz. Gaudís Kathedrale gehört mit Gaudís Worten und Zeichnungen zusammen, in denen er sein Verhalten und das der vielen Bauarbeiter usw. begründet und anleitet. Diese Sprachspiele sind ein Teil oder eine Phase des Verhaltens (an dem außer dem Architekten viele andere beteiligt sind), alles zusammen wäre das eigentliche Vergleichsobjekt. Ein Faustkeil wäre aber auch deshalb ein besseres Beispiel gewesen, weil der Handwerker ihn tatsächlich herstellt, während der Architekt die Kathedrale nicht selbst baut, sondern nur in Wort und Zeichnung plant. Dieses Planen, Besprechen, Anweisen, Begründen ist selbstverständich „bewußt“, und zwar im gleichen Sinn, wie das Urmeter in Paris bis zur Reform der Maßeinheiten genau einen Meter lang war, nämlich nicht durch Vergleich mit einem Eichmaß, sondern als dieses selbst: Im Handlungsdialog bildet sich überhaupt erst das Konstrukt von Bewußtsein, Wissen, Geist...Den Termiten würden in einem angemessenen Vergleich die Bauarbeiter entsprechen, die in der Tat keinen Plan der Kathedrale im Kopf haben müssen, sondern „Stein auf Stein“ setzen, wie die nächstliegende Anweisung es verlangt. Dennett versperrt sich den Weg zu einer wirklichen Naturalisierung. Termiten haben keinen Bauplan des Ganzen im Kopf. Gesteuert wird jeweils der nächste Schritt. Dabei wirken vermutlich Geruchssinn, im konkreten Fall auch Magnetsinn usw. zusammen. In Catania/Harnad (1984) kommt auch Dennett als Kritiker Skinners zu Wort; dieser weist ein Mißverständnis zurück und wundert sich über Dennetts „theological violence“. Dennett hatte einige Jahre zuvor seinen Aufsatz mit dem nicht sehr geschmackvollen Titel „Skinner skinned“ veröffentlicht. Seither hat er zwar unendlich viel gelesen, aber seine Ansichten niemals geändert. ("Theological"? Jedenfalls "repetitive", wie ein Kritiker schreibt.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.01.2022 um 08.43 Uhr |
|
Wale sind eigentlich Huftiere. Dawkins war erstaunt, als er diese neue Einsicht schon in Haeckels berühmtem Stammbaum der Säugetiere von 1866 fand: dort stehen die Cetaceae gleich über den Flußpferden, mit denen sie nächstverwandt sind. (Irrig war nur die Einordnung der Dugongs und Manatees.) Dies erklärt u. a. die querstehende Fluke und die Auf- und Abbewegung des Rückgrats: Wale galoppieren eigentlich durchs Wasser, anders als Fische. |
Kommentar von Theiodor Ickler, verfaßt am 31.12.2021 um 08.58 Uhr |
|
Das kleine, enge Tälchen am Dorfrand bietet dem Biber nur wenig Platz für seinen Damm und den dadurch erzeugten Stausee, der außerdem im Sommer lange trockenfällt (nur die kleinen Teiche daneben, Absetzbecken der aufgegebenen Ziegelei, sind immer halbwegs gefüllt). Um so schöner kann man vom Weg aus, der mitten hindurchführt, die (weitgehend nächtliche) Tätigkeit der Tiere beobachten. Weil sie keine Nutzflächen unter Wasser setzen, hat auch niemand etwas gegen die Ansiedlung. Sie liegt fast vor der Haustür und interessiert auch die Kinder. Biberdämme und -stauseen werden ebenso von Genen erzeugt wie Zähne und Schwänze. Große Biberdämme sind überhaupt die umfangreichsten Beispiele des „erweiterten Phänotyps“ (Dawkins). Die Gene steuern den Aufbau von Proteinen usw. direkt und damit das Verhalten indirekt. In einem völlig leeren Käfig führen Biber den Bau von Dämmen und das Anlegen von Stauseen im Leerlauf aus. Zwischen Körperteilen und Dämmen plus Seen besteht kein wesentlicher Unterschied. Bei Parasiten und ihren Wirten wird es noch interessanter (dazu das zweite Buch von Dawkins: The extended phenotype). Das Genom ist, wie gesagt, keine Blaupause des Phänotyps, sondern einer Sammlung von "Tools" (beim Programmieren) vergleichbar, wie Dawkins besonders in The ancestor’s tale ausführt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.05.2021 um 07.42 Uhr |
|
Immer mehr Einzelheiten der Erdgeschichte werden aus alten Gesteinen rekonstruiert. Die Information, die in Aufsätzen und Lehrbüchern enthalten ist, war aber nicht in den Gesteinen enthalten und ist dann in die Texte gewandert oder irgendwie dorthin transportiert worden. Wir haben hier an verschiedenen Stellen versucht, über Dennett und seinen Informationsbegriff zu diskutieren (Stichwort Jahresringe). Es war nicht möglich, weil Dennett die entsprechenden Thesen wahrscheinlich gedankenlos hingeschrieben hat. Wenn die wohlwollende Interpretation, mit der wir Philologen ja immer anfangen, wirklich nicht mehr geht, dann muß man eben mit menschlichem Versagen an der Quelle rechnen, und bei Dennett habe ich sowieso genügend Gründe – er hat viel Blendwerk hervorgebracht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.04.2021 um 04.50 Uhr |
|
Zu "Information" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1616#38197) Fast alles, was wir über das Weltall, seine Entstehung und seine Zukunft wissen, stammt aus der Spektralanalyse. Heute genügt es, das Spektrum eines Sterns zu analysieren, um dessen Geschichte zu rekonstruieren. Aber diese "Information" steckt nicht im Stern, sie steckt in dem Aufsatz, den der Astrophysiker darüber schreibt. Es ist dessen Mitteilung, nicht die Mitteilung des Sterns. Und dazu gehört die Beherrschung einer in Jahrtausenden entwickelten physikalischen Theorie und mathematischen Fertigkeit, erworben in jahrelangem Studium. Die Information entsteht hier auf der Erde, nicht da oben im Weltall. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2021 um 05.11 Uhr |
|
Thus, the meanings of words are stored along with their acoustical codes in Wernicke’s area. Broca’s area stores articulatory codes, and the angular gyrus matches the written form of a word to its auditory code. Neither of these areas, however, stores information about word meaning. The meaning of a word is retrieved only when its acoustical code is activated in Wernicke’s area. (Hilgard 15. Aufl. S. 50) So steht es im verbreitetsten Standardlehrbuch der Psychologie, und so wird es seit Generationen gelernt. Niemand weist auf die Sinnlosigkeit hin. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.01.2021 um 10.50 Uhr |
|
Zum "Speichermodell" noch dies: I do not believe that genes „tell“ the fertilized egg how to grow. Perhaps that metaphor will cause no harm, but it has caused a great deal of harm in the field of human behavior. People are changed by contingencies of reinforcement, they do not store information about them. (Skinner in A. Charles Catania/Stevan R. Harnad: The selection of behavior. The operant behaviorism of B. F. Skinner: Comments and consequences. Cambridge u.a. 1988:53) Wenn man weiß, in welchen Organismus die Gene eingebaut sind und wie er sie "abliest" (also auf sie reagiert, wie die Dampfmaschine auf den Fliehkraftregler), dann kann man aus den Genen eine "Information" rekonstruieren, aber diese Information steckt nicht in den Genen selbst. (Man darf das nicht mit dem informationstheoretischen Begriff von Information verwechseln, der auf jedes Muster angewendet werden kann.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.06.2020 um 04.31 Uhr |
|
The state of the world at any one moment is pretty much the same as it was in the previous moment: the world doesn’t change at random, capriciously. Like journalists reporting news, nerves reporting on the state of the world need to send a signal only when there is a change. Don’t say: ‘It’s loud it’s loud it’s loud it’s loud it’s loud it’s loud . . .’ Instead, say: ‘A loud sound has started. Assume no change until further notice.’ This is where ‘redundancy’ comes in as a technical term in information theory. Once you know the current state of the world, further reports of the same state are redundant. Redundancy is the inverse of information. Information is a mathematically precise measure of ‘surprise’. In the time domain, information means changes in the state of the world from one moment to the next, because only changes have surprise value. Redundancy in this context means ‘sameness’. The receiver of multiple messages doesn’t have to monitor all channels all the time: only those that signal a change. This could only fail to be helpful if the world changed randomly and capriciously all the time. Which, fortunately - well, obviously - it doesn’t. Redundancy filtering was Barlow’s engineering solution to the problem of economical signalling in the time domain, and - sure enough - it is implemented by nervous systems in the form of sensory adaptation. Most sensory systems send a rapid burst of spikes every time they detect a change, after which the spike rate settles down to a low or even zero rate until there is another change. There’s an analogous engineering problem in the spatial domain. If you think of an eye (or a digital camera) looking at a scene, most cells in the retina (or pixels in the camera) will be seeing the same thing as their neighbours in the retina (or camera). This is because the world’s scenes are not capriciously random, pepper and salt, but are typically made up of large patches of uniform colour like the sky or a whitewashed wall. Away from an edge, every pixel sees the same as its neighbours, and to report it is a waste of pixels. The economical way to convey the information is for the sender to report on edges and for the receiver (the brain in this case) to ‘fill in’ the swathes of uniform colour between the edges. Barlow pointed out that this engineering problem, too, has its neat, redundancy-reducing solution in biology. It’s called lateral inhibition. Lateral inhibition is the equivalent of sensory adaptation, but in the spatial, not the temporal domain. Each cell in the array of ‘pixels’, in addition to sending nerve spikes to the brain, inhibits its immediate neighbours. Cells that are sitting in the middle of a patch of uniform colour are inhibited from all sides, and therefore send only few, if any, spikes to the brain. Cells that are sitting on the edge of a patch of colour receive inhibition horn their neighbours on only one side. So the brain gets the majority of its spikes from edges: the redundancy problem is solved, or at least mitigated. Barlow introduced his article - and it was this that especially grabbed Marian’s and my imagination - with a mind-stretching thought experiment. Imagine that for every pattern the brain might ever want to recognize - every tree, every predator, every prey, every face, every letter of the alphabet, of the Greek alphabet - there was one nerve cell, hooked up to the retina in such a way that it fired when its ‘own’ shape fell on the retina. Each of these brain cells is wired up to a ‘keyhole’ combination of pixels so that it fires only when the correct ‘keyhole’ shape is seen. It also has to be wired up negatively to the ‘anti-keyhole’ (all the pixels other than the keyhole) otherwise it would fire when it saw a blank field of light covering the whole keyhole. That sounds fine, but on second thoughts it can’t be true. Remember that all the shapes needing to be recognized by these overlapping keyholes may be presented in thousands of different orientations and from any distance. The number of overlapping keyholes (with the rest of the retina in each case being an anti-keyhole) would be so prodigiously large that their corresponding brain cells would have to be more numerous than all the atoms in the world. Fred Attneave, an American psychologist who independendy thought up the same idea as Barlow, estimated that the volume of the brain would have to be measured in cubic light years! The solution - redundancy reduction - extends beyond sensory adaptation and lateral inhibition to a fascinating list of feature-detector neurones in the brain such as horizontal line detectors, vertical line detectors, ‘bug detectors’ and others, all of which can be represented as redundancy-reducing in the Barlow/ Attneave sense. For example, a straight line can be represented as just its two ends, leaving the brain to ‘fill in’ the redundant intermediate points. As with the bats and the spider webs, the whole Barlow story can be told as an elegant and easily memorized sequence of problems, with engineering solutions giving rise to new problems, suggesting new engineering solutions and so on. We should also expect that the ‘detector’ cells that evolve in the brain of an animal of a particular species will be tuned to detect not only features that are redundant in the sensory stream, but features that are functionally important for animals of that species - for example, the colour and shape of a sexual partner. These two combined would mean that a comprehensive list of the detector cells in an animal’s brain should amount to a kind of indirect description of the important properties of the world in which the species lives. (Dawkins) („Description“ ist nicht recht passend, weil es sich nicht um eine Sprache handelt.) Aber wenn die Wahrnehmung so funktioniert, wie es hier und in jedem Lehrbuch der Physiologie oder medizinischen Psychologie dargestellt ist – was bedeutet das für das „Gedächtnis“, und wie müssen Speichermodelle modifiziert werden? Das in Anführungszeichen gesetzte „fill-in“ sollte man auch noch weglassen. Weder in der Wahrnehmung noch in der Vorstellung („Ich sehe es genau vor mir“) noch in der Erinnerung wird etwas ausgefüllt. Lediglich die Illusion des lückenlosen Gesichtsfeldes wird erzeugt, weil sie praktisch ist und ja auch die wirkliche Lückenlosigkeit der Welt widerspiegelt, was der praktischen Orientierung zugute kommt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.06.2019 um 04.36 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, bevor ich auf die Frage ausführlicher eingehe, will ich nur schnell sagen, daß die Etymologie von remember (usw.) natürlich für Skinner kein Argument gegen die Annahme von Speicherung darstellt. Skinner benutzt die etymologischen Herleitungen (mehr als jeder Linguist sie bietet) nur als Hinweis auf die Herkunft unserer mentalistischen Konstrukte, gemäß seiner These, daß Etymologie die Archäologie unserer Gedanken sei.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.06.2019 um 00.48 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, ich folge dankbar jedem Ihrer Internetlinks, und schon so manches Buch, das Sie hier lobend erwähnt haben, habe ich mir umgehend bestellt. Es interessiert mich, auch wenn ich dann (eigentlich nur bei philosophischen oder psychologischen Themen) manchmal eine andere Meinung habe. Sie sagen, das Gehirn kennt keine Trennung von Arbeitseinheit und Speicher und braucht daher kein Lesegerät. Ja, aber das heißt doch nicht, daß nichts gespeichert ist und nichts gelesen werden muß. Das Gehirn ist alles in einem, ich sehe es als lebenden Speicher und Computer. Wie das Speichern und Lesen genau erfolgt, wissen wir nicht. Vielleicht ist der Speicher eines Lebewesens in ständiger Bewegung, Veränderung und Erneuerung. Das Gehirn braucht als Gesamtorgan keinen separaten Homunkulus als Leser oder Abrufer des Gespeicherten. Ich habe nie verstanden, weshalb dies eine zwingende Konsequenz der Speicherung bzw. des Recall sein soll. Braucht der Gebirgsbach einen Lotsen, der ihm zeigt, wo es langgeht? Das war ja Ihr Bild. Sie sagen und betonen übers Lernen: "Wenn man diese Veränderung zusätzlich (!) als Speichern beschreibt, ..." Aber wieso denn "zusätzlich"? Was genau ist das Zusätzliche des Speicherns von Lerninhalten gegenüber einer Veränderung des Organismus, z. B. einer Veränderung von Nervenverbindungen? Warum hat das veränderte Nervensystem keine Ähnlichkeit mit einem Speicher? Was hat denn Ähnlichkeit mit einem Speicher? Was verstehen Sie unter einem Speicher? Nehmen wir an, in einer Kiste befinden sich 5 schwarze Steine S und 5 weiße Steine W, zufällig angeordnet, z.B. WSSWSSWWWS Nun kommt jemand und sortiert alles wie folgt: WWWWWSSSSS Was ist passiert? Kein Stein ist abhanden- oder dazugekommen, mengenmäßig wurde nichts verändert, die Steine wurden nur in einer bestimmten Weise geordnet. Das heißt aber, es wurde eine Information hinzugefügt und "gespeichert". Diese Information ist natürlich interpretationsbedürftig, es ist von den äußeren Bedingungen abhängig, was sie genau bedeutet. SWSWSWSWSW wäre eine andere Ordnung (Information) mit möglicherweise anderer Bedeutung. So sieht Informations- bzw. Wissensspeicherung nach meiner Überzeugung auf der abstraktesten Stufe aus, und jeder Gedanke, jeder eingeübte Bewegungsreflex beruht auf diesem Prinzip. Was nicht gespeichert ist, ob nun Kartoffel oder Gedanke, Kniesehnenreflex oder Jongleurkunst, existiert auch nicht. Meiner Ansicht nach kann man nur zwei Arten von Dingen speichern: Materie (Stoffliches, Energie) oder Information (Daten, Fakten, Ideen, Wissen, d.h. faktisches Wissen, geistige Fähigkeiten, motorische Geschicklichkeit). Skinners Aufsatz über die Etymologie verschiedener Wörter des Denkens und Fühlens ist zweifellos sehr gut geschrieben und lehrreich, nur, wenn das Wort remember etymologisch nichts mit storage zu tun hat, wie er sicher mit Recht schreibt, dann ist das doch kein Grund anzunehmen, daß zur Erinnerung kein Speicher benötigt wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.06.2019 um 05.18 Uhr |
|
Darum heben Kritiker des Speichermodells vor allem eine Besonderheit hervor: Beim Computer ist die Arbeitseinheit vom Massenspeicher getrennt, während das Gehirn eine solche Trennung nicht kennt und daher kein "Lesegerät" braucht. Die Unähnlichkeit, die Sie mit Recht hervorheben, bringt die "Repräsentations"-Lehre in Verlegenheit, auch die Variante mit den "kognitiven Karten". |
Kommentar von R. M., verfaßt am 19.06.2019 um 19.36 Uhr |
|
Ein Festplattenspeicher hat allerdings auch schon keine große Ähnlichkeit mit einem Kornspeicher.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2019 um 17.23 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, ich will es gern noch einmal versuchen. "Wissen" hat für mich begrifflich einen anderen Ort als "Gehirn". Menschen sprechen miteinander, schreiben einander Wissen und Unwissen zu, das funktioniert ganz gut. Es ist die Alltagspsychologie (folk psychology) mit ihren Konstrukten. Man könnte umschreiben: Wissen ist die Fähigkeit, bestimmte Aussagen zu formulieren. Es wird auch als Ergebnis jedes Lernens (jeder Verhaltensänderung) angesehen: Wenn ich irgendwo gewesen bin, weiß ich, wie es dort aussieht, wie man dort an ein Ziel gelangt usw. Dieses "Wissen" kann reproduziert werden, man kann es auch vergessen und sich wiedererinnern. Lernen hinterläßt einen veränderten Organismus. Vor allem ein verändertes System von Nervenverbindungen, die dann ein verändertes Verhalten steuern. Wenn man diese Veränderung zusätzlich (!) als Speichern beschreibt, fügt man etwas hinzu, was schwere Probleme aufwirft. Schon Platon behandelt (im "Theaitetos") das Wachstafelmodell und andere Modelle und scheitert an der Frage des "Abrufs" (retrieval, sagt man heute). Das habe ich alles schon mehrmals diskutiert, auch die unangenehme Homunkulus-Konsequenz. Ich bestreite also nicht (erst) die Speicherung im Kopf, sondern schon die Tunlichkeit einer solchen Begrifflichkeit. Warum wollen Sie denn unbedingt dabei bleiben? Warum sollte man das veränderte Nervensystem "Speicherung" nennen, wenn es doch überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Speicher hat? Ob Sie mal diesen kurzen Aufsatz von Skinner lesen, einen seiner letzten? https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/skinner.htm (Vielleicht haben Sie es schon getan, dann bitte ich um Entschuldigung.) |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.06.2019 um 17.03 Uhr |
|
Lieber Prof. Ickler, es bringt ja nichts, gegen eine ganz bestimmte Art und Weise der Speicherung (z.B. in Form einer Enzyklopädie) zu polemisieren, solange Sie überhaupt jegliche Speicherung von Wissen im Gehirn bestreiten. Wenn es keine Wissensspeicherung gibt, dann ist natürlich das Bild von einer Enzyklopädie im Kopf trivialerweise unsinnig. Um dieses Bild zu widerlegen, müßten Sie sich einmal auf die These einlassen, daß Wissen grundsätzlich im Gehirn gespeichert sein könnte. Dann könnten Sie sagen, es mag wohl irgendwie gespeichert werden, aber jedenfalls aus diesem und jenem Grund nicht als eine Art von Enzyklopädie. Und dann müßten Sie dazusagen, was an diesem Bild (denn es ist natürlich immer noch nur ein bildhafter Ausdruck) so schief ist. Es beschreibt natürlich nicht das ganze Bewußtsein, aber ein Teil unseres Bewußtseins besteht nach gängiger Auffassung aus Faktenwissen oder deklarativem Wissen. Was spricht dann dagegen, daß man sich diesen Teil als Enzyklopädie vorstellt? Ich verbinde mit dem Wort Enzyklopädie natürlich keine alphabetisch oder hierarchisch nach Stichworten oder Gebieten geordnete Wissenssammlung mit fixen Erklärungen. Aber ich finde, als Sammlung von bestimmten Fakten und dazugehörendem Wissen kann man beides, Enzyklopädie und den entspr. Teil des Gedächtnisses, durchaus verstehen. Vielleicht träfe es ein vielfach verlinktes, sich ständig änderndes Netz nach Art der Wikipedia noch besser als eine Enzyklopädie. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2019 um 14.03 Uhr |
|
Der Hippocampus (...) ist wesentlich für die Abspeicherung von deklarativem Wissen und kontextgebundenen Informationen verantwortlich. (Ulrike Ehlert u. a.: Biopsychologie. Stuttgart 2013:73) = Der Hippocampus wirkt bei der Steuerung von Reaktionen mit, von denen ein bestimmter sprachlicher Teil linguistisch als Deklarativsätze interpretiert wird. Der Text scheint dem volkstümlichen Bild zu folgen, wonach im Gehirn eine Art Enzyklopädie „gespeichert“ wird. Man spricht auch von „propositionaler Speicherung“, was aber physiologisch keinen Sinn ergibt. Propositionen gehören zum Sprachverhalten. "Abspeicherung deklarativen Wissens" ist eine der unzähligen Gedankenlosigkeiten, die dahingeplappert werden. Und dabei kommt man sich gar sehr überlegen vor, nämlich über den "mechanistischen Behaviorismus". |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.06.2019 um 06.32 Uhr |
|
Am Ende unserer Schulzeit kennen wir uns in mehreren Wissensgebieten aus, die in unserem weiteren Leben keine Rolle mehr spielen. Je mehr Zeit verstreicht, desto schwerer fällt es uns, das ehemals Gelernte zu rekapitulieren, irgendwann können wir nur noch sagen, dass wir uns einmal in diesem Gebiet ein wenig auskannten. Unser Hirn hat dann offenbar entschieden, die Energie zur Aufrechterhaltung des Langzeitgedächtnisses abzuziehen, da dessen Inhalt längere Zeit nicht mehr aktiviert wurde und die gespeicherten Lernakte für den Organismus offenbar bedeutungslos geworden sind. Es wird vergessen. (Randolf Menzel: Die Intelligenz der Bienen. München 2016:228) Aber steht denn fest, daß zur Aufrechterhaltung des Gedächtnisses fortwährend „Energie“ nötig ist? Schrift erfordert keine Energie zu ihrer Erhaltung, ebenso die Speicherung auf einer CD. Abgesehen davon, daß das Gehirn nichts „entscheidet“. Schrift verblaßt, aber das Papier entscheidet nicht darüber. Was sind „gespeicherte Lernakte“? Akte können doch nicht gespeichert werden. Das ist alles sehr unklar, in bedauerlichem Gegensatz zu den wertvollen neurophysiologischen Ergebnissen des Bienenforschers. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2019 um 08.18 Uhr |
|
Das kommt in der Kürze etwas mißverständlich heraus. Das Auswendigspielen steht im Gegensatz zu "nach Noten". Die hat man beim Auswendigspielen hinter sich gelassen. Ich brauche wohl noch etwas Zeit, um diese Begriffe zu klären und dem Sprachgebrauch gerecht zu werden. Für Hilfestellung bin ich dankbar, denn auswendig weiß ich es nicht. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 19.02.2019 um 07.53 Uhr |
|
Klavierspielen ist kein Tun?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.02.2019 um 04.37 Uhr |
|
Der Unterschied von kennen und können trifft es. Bei Tieren sagt man nicht, daß sie etwas auswendig können. Ich habe gegen Duden Zweifel angemeldet, vor allem wegen Tanzen: Eine Schrittfolge kann man auswendig kennen, aber man tanzt nicht auswendig. Die Google-Suche zeigt, daß Tänze auswendig gespielt, aber nicht auswendig getanzt werden. Man kennt oder weiß etwas auswendig, aber man tut es nicht auswendig. auswendig aufsagen ist sehr viel häufiger als aus dem Kopf aufsagen. Wir wissen, wie wichtig der Kopf beim Denken ist, aber das scheint den gewöhnlichen Sprechern egal zu sein. Das Gehirn war für unsere Vorfahren lange Zeit nur eine Delikatesse, für Aristoteles ein Kühlorgan. Wie hätte man ohne neurologische Einsichten auch erraten können, was das Gehirn eigentlich macht? Heute beginnen wir zu verstehen, wie der Körper funktioniert, unsere Vorfahren wußten bis in die jüngste Zeit nichts davon. Man staunt, wie spät der Blutkreislauf entdeckt wurde, nachdem Milliarden von Tieren geschlachtet worden waren... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2019 um 00.53 Uhr |
|
Was Engländer "by heart" machen, das machen wir Deutschen "aus dem Kopf", wobei ich letzteres viel logischer finde. Das Denkorgan sitzt schließlich (auch schon rein gefühlsmäßig) im Kopf, nicht im Herzen. Man sagt "auswendig" (oder "aus dem Kopf") außerdem nur bei solchen Gedächtnisleistungen, die nicht ganz trivial und alltäglich sind. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 19.02.2019 um 00.20 Uhr |
|
Alles was man kennen (bzw. wissen) muß, sozusagen reine Daten, kann man auswendig lernen oder vortragen, was man hingegen können muß (motorische und geistig-methodische Fähigkeiten), bezeichnet man nicht als auswendig gelernt. Etwas auswendig zu lernen und zu tun ist eine Gedächtnisleistung, man verwendet den Begriff auswendig nicht bei Leistungen, die auf eingeübten Reflexen oder ständig neuen Folgerungen (z. B. bei einem laufenden Schachspiel) beruhen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2019 um 13.58 Uhr |
|
Zu "Gewand" bietet das Deutsche Wörterbuch einen richtigen kleinen Aufsatz. Zur Tuchherstellung fällt mir noch ein, daß auf Runges berühmten "Hülsenbeckschen Kindern" ganz in der Ferne Tuchbahnen von einem Gebäude herabhängen, offenbar zum Trocknen an einer Färberei. Ich glaube, bei Jörg Träger steht der Hinweis, daß damit dezent angedeutet wird, woher die Hülsenbecks ihren Wohlstand haben. Aber noch einmal zu "auswendig": Was kann man überhaupt auswendig lernen? Texte, Musikstücke, aber nicht Radfahren, Bogenschießen. Auch Handlungsfolgen wie Musikstücke, Tänze, Schachpartien, Kochrezepte und Ähnliches können auswendig gelernt werden. (Wikipedia) Wirklich? Man kann sich nicht auswendig anziehen, auswendig Schuhe zubinden... Auch wenn wir für die Klasse von Gegenständen, die man auswendig lernen kann, keine Bezeichnung haben, ist sie doch eine natürliche Klasse, und es ist anzunehmen, daß sich ein definierendes Merkmal (oder ein Bündel von solchen) finden läßt. Der Anwendungsbereich wird nicht scharf begrenzt sein. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 18.02.2019 um 10.43 Uhr |
|
Zu auswendig paßt auch das Wort Gewandhaus, das ich heute morgen zufällig im Radio hörte. Woher kommt dieser Name, was hat es mit Gewändern oder mit wenden zu tun? Ich dachte, dort wird Musik gemacht? Ein Blick in Wikipedia zeigt, daß Gewandhäuser tatsächlich aus Tuchhallen entstanden sind, wo früher Stoffe gewendet (gefaltet) und gelagert wurden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.02.2019 um 05.33 Uhr |
|
„auswendig lernen“ ist ein sonderbarer Ausdruck. Duden meint: „eigentlich = von außen, ohne in das Buch zu sehen“. Vielleicht stammt es eher aus dem Gegensatz „in- und auswendig“ = von Herzen und „apo stomatos“ (wie beim bloßen Aufsagen; Hinweis im Deutschen Wörterbuch). Englisch „by heart“ und französisch „par cœur“ samt Entsprechungen in anderen Sprachen stellen die Sache gerade andersherum dar. Damit ist aber keine Lerntheorie verbunden, etwa über die Beteiligung des Herzens am „Speichern von Informationen“ (auch so eine Metapher). Man verwendet all diese Ausdrücke sozusagen gedankenlos, und gerade darum erfüllen sie ihren Zweck.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2019 um 05.45 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1616#39898 Um noch einmal die Analogie des Kuchenbackens zu bemühen: Im Rezept zum Backen eines Kuchens ist an keiner Stelle der gesamte Kuchen enthalten ("repräsentiert"); er ergibt sich aus der Abfolge der beschriebenen Schritte, die einige Leerstellen enthalten, weil in der Wirklichkeit der Küche etwas geschieht, was zwar "vorgesehen" ist (als notwendige Bedingung des jeweils nächsten Schrittes), aber nicht dargestellt. Es müßte sich feststellen lassen, wie starr die einzelnen Schritte im Verhalten der Spinne aufeinander folgen. Zu vergleichen sind die Schritte bei der Herstellung eines Autos oder Flugzeugs, wenn alle Arbeiter ihre Teile einbauen und nirgendwo mehr der Gesamtplan aufzufinden ist. Nur daß eben in der Natur die Evolution dahintersteht und ein Gesamtplan niemals vorhanden war. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.01.2019 um 05.38 Uhr |
|
Zwischen dem Rezept und dem Kuchen besteht keine "Isomorphie", darum kann man nicht von Abbildung oder Repräsentation sprechen. Das gilt für alle Programme. Die Anpassung der Organismen an ihre Umgebung besteht im wesentlichen in der Ausbildung solcher Programme. Sie ermöglichen dem Organismus den erfolgreichen (überlebensdienlichen) Umgang mit seiner Umgebung, bilden diese aber nicht ab. (Das verkennt die "evolutionäre Erkenntnistheorie", jedenfalls gewisse Vertreter.) Man kann das auf die Sprache übertragen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.12.2018 um 06.22 Uhr |
|
Haben zwei Personen etwas gemein, wenn der eine essen und der andere schlafen will? Beide wollen etwas, aber man könnte auch sagen, der eine sei müde und der andere hungrig, und dann ist die Gemeinsamkeit schon weniger eindrucksvoll. Einer will nach Moskau reisen, der andere Architekt werden, ein dritter will Korrektur lesen – was haben sie gemein? „Da drüben geht Herr Meier, er will Architekt werden.“ Man könnte ihn noch so gründlich untersuchen, nie würde man feststellen, daß er Architekt werden will. Die Eigenschaften, die er hat, würden unter gewissen Umständen dazu führen, daß er Architekt wird, aber das ist aus seinem System nicht zu entnehmen. Der Architekt, der er einmal sein wird, ist in ihm nicht „repräsentiert“ – wie der Kuchen nicht im Backrezept repräsentiert ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.10.2018 um 05.53 Uhr |
|
„Wählt“ die Kreuzspinne zwischen den sieben Spinndüsen, die chemisch verschiedene Fäden für verschiedene Zwecke ausstoßen? Der anthropomorphe Begriff der „Wahl“ ist unangebracht. Die Spinne „weiß“ auch nicht, was sie tut; solche Ausdrücke sind fernzuhalten. Es muß im Verlauf des Netzbaus und der Brutpflege Auslöser geben, die das Verhalten steuern. Erstaunlich ist die Geschicklichkeit der eigentlich unbeholfen wirkenden acht Beine, ebenso die Genauigkeit, mit der die Spinndüse am Hinterteil den Spiralfaden an die Speichen des Netzes heftet, offenbar ohne visuelle Kontrolle. S. etwa hier: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=3968. Das Verhalten sieht wie überlegt, das Ergebnis wie geplant aus; aber wir wissen, daß es nicht so ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.10.2018 um 17.20 Uhr |
|
„Spinnennetze sind architektonische Meisterleistungen.“ – Solche Sätze liest man oft und kann nur zustimmen. Erst im Licht der Evolution kann man versuchen, das scheinbare Wunder aufzulösen. Und wieso sind alle Netze der Kreuzspinne gleich aufgebaut? Der Bau dieser heimtückischen Insektenfalle verläuft immer nach einem Muster, denn den „Bauplan“ hat die Spinne seit ihrer Geburt im „Kopf“. (https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/spinnentiere-netzbau) Aber nicht als Plan, sondern als Rezept. Jeder Schritt steuert den nächsten. Wenn der Plan „im Kopf“ wäre, müßte er dort hineinkonstruiert worden sein – durch ein Rezept in der DNS, wo es ja nicht wieder einen Bauplan geben könnte usw. ins Unendliche. Außerdem müßte der Übergang vom Plan im Kopf zur wirklichen Herstellung des Netzes erklärt werden. So einfach sollte man es sich mit den „Bauplänen“ nicht machen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.09.2018 um 14.17 Uhr |
|
In „Gehirn und Bewußtsein“ (Heidelberg 1994:68) ist von der „Repräsentation eines Musikstücks“ die Rede, die vom Geiger durch Bogenführung und Fingerbewegung umgesetzt wird. Offenbar am Notentext orientiert, aber physiologisch bisher ohne Sinn und nicht nachprüfbar. Andere Bewegungsfolgen, z. B. Tanz oder Sport, haben doch auch kein Skript, weil es hierfür keines gibt, das der Notenschrift entsprechen würde.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.07.2018 um 10.06 Uhr |
|
Wie finden Eichhörnchen (manchmal) die versteckten Nüsse wieder? https://www.geo.de/natur/tierwelt/18520-rtkl-endlich-verstehen-wie-finden-eichhoernchen-eigentlich-ihre-versteckten Die Zwischenüberschrift „Eichhörnchen verfügen über eine innere "Schatzkarte" wird durch die berichteten Untersuchungen nicht gerechtfertigt. Vielmehr scheinen die Eichhörnchen die Nüsse dort zu suchen, wo sie sie auch verstecken würden, mit großer Unsicherheit: „Viele der Snacks – Schätzungen reichen von 25 bis 75 Prozent – verbleiben im Boden (und tragen, wenn sie austreiben, zur Waldentstehung bei).“ Diese Erklärung wird in der Literatur kaum erwogen. Außerdem spielt der Geruchssinn wohl eine Rolle. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.07.2018 um 08.14 Uhr |
|
Als Verhalten ("behavior") bezeichnen aufgeklärte Behavioristen wie Mead alles, was sich an einem Lebewesen im Laufe der Zeit verändern kann. (Roland Posner in „Die Welt als Zeichen“, S. 56). Dann wäre Haarausfall auch ein Verhalten. Das ist nicht sehr sinnvoll. Es verdeckt den entscheidenden Unterschied zwischen (bestenfalls) Anzeichen und wirklichen Zeichen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.07.2018 um 04.33 Uhr |
|
Aus dem Schnabel eines Tiers kann man Schlüsse auf seine Beute ziehen, aber diese ist nicht im Schnabel „repräsentiert“, wie Dennett mit Recht feststellt (From bacteria to Bach and back. Penguin 2017:79). Das läßt sich auf vieles übertragen. In einem Programm, z. B. in HTML geschrieben, ist das Ergebnis seiner Ausführung nicht "repräsentiert", es gibt auch keine Isomorphie zwischen ihnen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.07.2018 um 05.10 Uhr |
|
Rezepte (= Programme) sind dem Ergebnis ihrer Ausführung nicht isomorph. (Wenn ich ein Programm in HTML schreibe, ist es doch dem Ergebnis seiner Ausführung nicht isomorph.) Die Ausführung eines Verfahrensschrittes bewirkt etwas (in der Umgebung, in der Peripherie), was nicht im Rezept enthalten ist; dann folgt der nächste Schritt. Das will man neuerdings mit Embodiment erfassen. Außerdem ist in „Korrespondenz“ und „Anpassung“ schon die Repräsentation untergebracht. (Hefe mit Mehl und warmem Wasser vermischen – danach setzt etwas ein, was nicht im Rezept steht, sondern in der Wirklichkeit stattfindet und sie verändert. In dieser veränderten Wirklichkeit geschieht der nächste Schritt. Wirklichkeit und Rezept sind darum nicht Punkt für Punkt aufeinander abzubilden. Die Welt ist auch nicht im Kopf, sondern der Kopf steuert das Verhalten des ganzen Körpers unter dem Einfluß bestimmter Merkmale der Welt. Jeder Griff verändert die Umgebung in einer Weise, die nicht im steuernden, angepaßten Hirn repräsentiert sein kann.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.05.2018 um 05.25 Uhr |
|
Nach Chomsky und seinen Nachfolgern kann in der Endkette der sprachlichen Zeichen (de facto beschränkt auf das Format des Satzes) nichts enthalten sein, was nicht aus der "Regel", einer Erzeugungsformel, algorithmisch abgeleitet ist. Diesem mathematischen Blaupausenmodell ist das physiologische Rezeptmodell entgegenzustellen. Ein erster Impuls wird ausgelöst und bewirkt etwas nicht Vorherbestimmtes in seiner Umgebung (wie die Hefe aufgeht und ihre Umgebung in der Teigschüssel verändert). Dann folgt die nächste Instruktion, die sich in der so veränderten Wirklichkeit auswirkt usw. Bei der Aktualgenese des Sprachverhaltens und jedes anderen Verhaltens spielt diese Umgebung, die in keinem Sinne in der "Regel" enthalten ist, die entscheidende Rolle, denn sie ist längst durch Phylogenese und frühere Konditionierung (Lernen) so verändert, daß am Ende eine an die Umwelt angepaßte Reaktion herauskommt. Im Kuchen-Vergleich: Längst ist die passende Mehlmischung bereitgestellt, in der die Hefe den gewünschten Kuchen hervorbringen kann. Dieses Modell gehört zu den "inkrementellen" Theorien der Aktualgenese, die allerdings, wie die Erfahrung zeigt, durchaus mit der grundverkehrten Vorstellung vom Sinn als Ausgangsstadium einhergehen kann. Davor muß man sich also hüten; hier könnte auch das Kuchenbacken in die Irre führen, weil der Bäcker ja eine bestimmte Absicht hat. In der Natur gibt es aber keine Absichten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.05.2018 um 09.59 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1616#31316 und zum "fliegenden Start": Ich will mir eine Seitenzahl aus dem Register merken und spreche 210 vor mich hin, obwohl ich ganz deutlich 211 gelesen habe und auch tatsächlich diese Seite aufschlage, also vom Gesehenen und nicht vom Gemurmelten gesteuert werde. Der visuelle Eindruck löst 211 aus, wie ich es gelernt habe, aber der Vorgänger und der Nachfolger der Zahlenreihe stehen ebenfalls Schlange, da kann es schon mal passieren, daß einer sich durchsetzt. Eine ziemlich große Zahl von Verlese-Fehlern kommt so zustande. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2018 um 07.43 Uhr |
|
"Bienen sind zudem imstande, Landmarken im Gedächtnis abzuspeichern", betont der Experte. Dabei orientieren sie sich am Erdmagnetfeld und der Sonne und finden reichhaltige Futterplätze wieder. (https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Wie-finden-Bienen-die-Blueten-article16983221.html) „speichern“ fügt etwas hinzu, was man nicht weiß, und „im Gedächtnis“ ist tautologisch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.03.2018 um 04.34 Uhr |
|
Die Informationstheorie berechnet die Vorkommens- und Übergangswahrscheinichkeit von beliebigen Objekten. Das können natürlich auch Buchstaben oder Wörter sein, also Zeichen, aber das wäre Zufall. Schon deshalb hat dieser Begriff von Information nichts mit der Bedeutung oder dem Inhalt von Nachrichten zu tun. Das wäre zu bedenken, wenn man von "Informationsverarbeitung im Gehirn" spricht. Das Gehirn steuert das Verhalten und andere physiologische Prozesse. Dazu nimmt es auch Umweltreize auf. Aber es gibt keinen Grund, von Informationsverarbeitung zu sprechen, wenn man noch gar nicht weiß, was vorliegt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.03.2018 um 16.51 Uhr |
|
Es hat schon Tagungen über "Information" gegeben, bei denen die Teilnehmer aneinander vorbeiredeten. Die Geisteswissenschaftler und Juristen verwendeten den allgemeinen bildungssprachlichen Begriff, der ungefähr "Mitteilung, Benachrichtigung, Unterweisung, Bildung" bedeutet, die Naturwissenschaftler und Mathematiker den informationstheoretischen, also mathematisch-statistischen nach Shannon usw. (zum Beispiel 2009 in Freiburg). Und dazu kommt noch ein dritter Begriff, der mich besonders interessiert. In den Eisblumen am Fenster steckt die Nachricht, daß es draußen weit unter null Grad ist, in den Baumringen die Information über das Klima der letzten Jahrhunderte usw. (zwei klassische Beispiele aus der Literatur). Beides ist nicht zeichenhaft und nur im metaphorischen Sinn Mitteilung, Nachricht.
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 16.03.2018 um 13.21 Uhr |
|
Ich wollte den Zeichenbegriff gar nicht berühren, das "künden" war ganz unscharf, umgangssprachlich gemeint. So eine "Spur" ist viel zu grob als daß sie eindeutige Schlüsse zuließe. Ich wollte nur sagen, wie ich mir das Grundprinzip der natürlichen Informationsspeicherung vorstelle.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 18.20 Uhr |
|
Zu "Sprache und Erinnerung" s. hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1626#29147 Und hier: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1626#30961 Ich muß schon wieder nachsehen, was denizen heißt. Ob ich mir die Etymologie merken kann? Latein ist mir doch nicht ganz unbekannt. Warten wir’s ab. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 17.30 Uhr |
|
Für das Gedächtnis ist wohl die Verwirrung und Konfusion des Gelernten zu besorgen, aber doch nicht eigentliche Überfüllung. (Schopenhauer P. II: 641) Vgl. auch seine Beobachtungen hier: http://www.textlog.de/23034.html Ganz interessant. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 17.05 Uhr |
|
"Künden"? Das führt zu der anderswo kritisierten Zeicheninflation. Ich will nicht wiederholen, was ich hier geschrieben habe: http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#31975 Ein bißchen lang, aber vielleicht liest es mal jemand... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.03.2018 um 16.58 Uhr |
|
Wie Herr Virch auch schon sagt, ist die Speicherung realer Gegenstände etwas anderes als die Speicherung von Information. Im Zusammenhang mit dem menschlichen Erinnerungsvermögen geht es ausschließlich um die Speicherung von Information (Wissen) aller Art. Und da ist diese letzte Darstellung von Ihnen, lieber Prof. Ickler, tatsächlich genau das, was ich mir unter den Grundlagen der Informationsspeicherung vorstelle. Die vom Blitz ionisierte Luft ist natürlich schnell verpufft, aber ein Blitzeinschlag an einem Baum kann noch jahrelang von diesem Moment künden. Jede solche Spur ist letztlich ein Informationsspeicher. Im Gehirn von Lebewesen ist das alles noch sehr verfeinert, die Spuren sind nicht nur rein mechanischer, physikalischer Art, aber prinzipiell ist es m. E. genau so. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 16.00 Uhr |
|
Ich habe verschiedene Narben, das sind Veränderungen des Körpers... Ein Blitz hinterläßt auch eine Spur (ionisierte und erhitzte Luft) – ist das eine Speicherung (wovon?)? Das schon erwähnte Rinnsal hinterläßt ein Spur im Sand, das Bett künftiger Rinnsale (wie beim Blitz, der weiteren Blitzen den Weg bereitet). Von Speicher spricht man doch sonst, wenn etwas aufbewahrt wird und wiedergefunden werden kann (retrieval). Aber mal zu den Geschwindigkeiten: Ich habe nicht gesagt, daß sie gemessen worden sind, aber sie sind tatsächlich teilweise schon gemessen worden. Und das setzt Spekulationen gewisse Grenzen. Bei einem kortikal gesteuerten Verhalten wie dem Sprechen sind nicht nur die zuerst sichtbar gemachten Hauptzentren, sondern Dutzende beteiligt, praktisch das ganze Gehirn ist mehr oder weniger aktiviert, wenn ein einzelnes Wort im natürlichen Kontext artikuliert wird. Das erfordert eine gewisse Zeit. Durch die Versuche von Libet und vorher von Kornhuber wissen wir, daß eine Willkürhandlung sich in etwa 500 Millisekunden allmählich aufbaut, ohne daß der Proband etwas davon "weiß" ober bemerkt. Das ist eine ewig lange Zeit. Und es sind durchaus beachtliche Strecken zurückzulegen (Meter, Kilometer?). Die "Suche" nach einem Wort dauert um so länger, je seltener es ist (neben anderen Parametern); das hat die Pausenforschung ergeben, beim Hören ist es entsprechend schwieriger, weshalb die Pausen, die der Sprecher macht, dem Hörer sehr gelegen kommen. Das sind durchaus mäßige Geschwindigkeiten, die der "Geist" nicht überschreiten kann und die sicher auch von vornherein mit den Möglichkeiten der Motorik abgestimmt sind. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.03.2018 um 14.20 Uhr |
|
Vielleicht ist es eine Petitio principii, weil es nichts zu beweisen gibt. Ein Sinneseindruck ist eine Veränderung des Körpers, das wiederum ist eine Speicherung von etwas. Die Ursache bewirkt eine mehr oder weniger lang anhaltende physische Spur. Solange sie da ist oder erneuert wird, ist diese Ursache in uns fühlbar präsent, eben gespeichert. Die Frage, wie schnell das Erinnern u. a. geistige Vorgänge sind, habe aber nicht ich ins Spiel gebracht. Sie, lieber Prof. Ickler, haben doch mit dem Paradoxon den Eindruck erweckt, die Geschwindigkeit solcher Vorgänge sei schon gemessen worden. Wenn wir das nie werden sagen können, dann vergessen wir einfach das Paradoxon, das ist ja alles, was ich wollte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 12.46 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, solange Sie auf diesem "selbstverständlich" bestehen – also einer Petitio principii, denn darum geht es ja gerade –, kommen wir nicht weiter. Und was Sie über das Messen sagen, immunisiert Ihre Ansicht gegen jede empirische Widerlegung. Über die nichtbeobachtbaren geistigen Vorgänge des Suchens, Findens usw. (meiner Ansicht nach nur Konstrukte, keine wirklichen Ereignisse) werden wir nie sagen können, wie schnell sie sind. Ich weiß nicht, ob ein Pianist sozusagen innerlich schneller spielt als äußerlich. (Manchmal laufen einem auch die Finger davon.) Es gibt ja so etwas wie ein Fingergedächtnis, und es gibt Struktureinsichten, die dem Musiker an jeder Stelle sagen, wie es sinnvollerweise weitergeht. Eine Skala oder einen Triller schöpft er dann aus den Routinen (das Kleinhirn hilft bei der Ausführung). Manche Leute haben die Ilias auswendig gelernt. Da ist es ebenso: Manches reproduzieren sie mit fliegendem Start, aber sie können auch das Handlungsschema der 24 Gesänge beschreiben, wenn sie danach gefragt werden. Habe ich (schon mal erwähnt) den Stadtplan von Mannheim im Kopf? Nicht im geringsten. Trotzdem bin ich sicher, das IDS zu finden, d.h. an jeder Kreuzung zu wissen, wie es weitergeht. Das Ganze ist etwas rätselhaft, aber mit dem Allerweltsbegriff "Speicher" ist nichts gewonnen. Je mehr der Barde im Kopf hat (ich drücke mich populär aus), desto leichter fällt es ihm, noch etwas hinzuzutun. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 15.03.2018 um 11.53 Uhr |
|
Wir wissen gar nicht, ob der Pianist mit jeder neu gelernten Sonate länger braucht, die Töne aus der Erinnerung herauszusuchen. Es hat noch niemand gemessen. Er findet die Töne, obwohl er vielleicht wirklich immer länger dazu braucht, immer noch viel schneller, als er in der Lage ist, sie zu spielen. Deshalb bemerken wir es einfach nicht, falls er länger zum Erinnern (Suchen, Kramen) braucht. Genauso ist es mit den Wörtern beim Sprechen. Vielleicht steigt die "Nachschlage"-Zeit mit der Anzahl gemerkter Wörter, aber sie ist immer noch so kurz, daß wir während des Sprechens bequem weiter nachdenken können, es gibt beim Sprechen einen regelrechten Gedanken-"Stau". Dieses angebliche Paradoxon ist einfach untauglich, die Speicherung von Bewußtseinsinhalten zu widerlegen, weil wir noch gar nicht wissen, wie diese Speicherung wirklich funktioniert und organisiert ist. Aber für existentielle Fragen spielt das auch keine Rolle. Natürlich ist das kein Speicher realer Dinge in der Art von Regallagern oder Lexika wie z. B. von Geruchsproben, Tonaufnahmen, Bildern oder Buchstaben, sondern ein Speicher von Information und Sinnes-"Eindrücken". Jede Veränderung des Organismus (jeder "Eindruck" in den Organismus) speichert selbstverständlich etwas, auf kurz oder länger oder für Lebzeiten. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 15.03.2018 um 10.43 Uhr |
|
Die Bezeichnung Speicher ist zweifellos schief. Anders als Getreide- oder Wasservorräte nimmt Gelerntes bei der „Entnahme“ schließlich nicht ab, und ein Pianist wird auch nicht mit jeder neu gelernten Sonate langsamer. Das Gedächtnis, auch das der Finger, wird im Gegenteil immer besser. Improvisierende Jazzmusiker, die Fertig- und Halbfertigteile virtuos mit spontan Erzeugtem mischen, kramen gewiß nicht in Speichern, ihr Organismus hat Veränderungen hinter sich. Leider sind diese nur mit viel Mühe herbeizuführen und setzen obendrein einen geeigneten Organismus (Talent) voraus.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 09.31 Uhr |
|
Er hat immer genug Korn zu essen, also muß er einen Speicher haben. (Bemerken Sie die feine Anspielung? Speicher < spicarium...) Muß er nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, man muß sie nur zu denken wagen. Hier noch meine Blütenlese zum Speichern: „Die Hirnforschung der letzten Jahre hat deutlich gemacht, dass man diesen Sprachbesitz der Lernenden im Deutschunterricht nicht einfach ausklammern darf: Wir speichern unsere lautlichen Erinnerungen im sensorischen Sprachenspeicher der linken Großhirnrinde. Hier sind sie durch Nervenverbindungen, die Synapsen, in einem ganzen Netzwerk von Bildern und Vorstellungen mit unseren Erfahrungen und Gefühlen vielfältig verknüpft, keinesfalls sauber nach Sprachen getrennt. Wir speichern Sprache auch keinesfalls nur lautlich, sondern multimodal - unser Gehirn speichert auch die Wortbilder, ebenso wie situative und affektive Merkmale. Multimodale Repräsentation nennen wir diese Mehrfachvernetzung und Mehrfachspeicherung.“ usw. (Deutschdidaktiker Hans-Jürgen Krumm in Fremdsprache Deutsch, Sondernummer II/1997, S. 13) „Unser Sprachvermögen, das im Gehirn gespeichert ist, sorgt normalerweise für den passenden und richtigen Ausdruck.“ (Richard Schrodt: Wozu Grammatik?) Wir konnten nachweisen, dass die Gefühle das Einspeichern der Wörter beeinflussten: Es wurden diejenigen Wörter am besten erinnert, die in einem positiven emotionalen Kontext eingespeichert wurden. Darüber hinaus konnten wir zeigen, dass das Einspeichern emotionsabhängig in unterschiedlichen Gehirnregionen erfolgt: bei positiven Emotionen im Hippocampus und bei negativen Emotionen im Mandelkern. (...) Inhalte, die im Mandelkern gespeichert sind, führen damit bei ihrem Abruf automatisch zu körperlichen Reaktionen von Angst. (...) Der Hippocampus speichert Einzelheiten dann, wenn sie zwei Qualitäten aufweisen: Neuigkeit und Bedeutsamkeit. (Manfred Spitzer) Mit Hilfe bildgebender Verfahren konnte der Hirnforscher Manfred Spitzer unlängst nachweisen, daß man sich an solche Wörter am besten erinnert, die in einem positiven emotionalen Kontext gespeichert wurden, und daß das Speichern emotionsabhängig in unterschiedlichen Gehirnregionen erfolgt: bei positiven Emotionen im Hippocampus, bei negativen im Mandelkern. (Christian Geyer FAZ 5.7.04; Spitzer ist Psychiater) „Gehirn speichert Verben und Hauptwörter getrennt“ (MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften 2010) Vorstellungen sind nicht nur ´Bilder im Kopf´, sondern meist (...) als verbale oder bildlich-abstrakte Propositionen gespeichert. Eine Proposition ist ein Bedeutungsinhalt, der in der Regel aus einem einfachen Satz oder Wort besteht." (Birbaumer/Schmidt 1991:621) "Unter Gedächtnis verstehen wir die lernabhängige Speicherung ontogenetisch erworbener Information, die sich phylogenetischen neuronalen Strukturen selektiv > artgemäß einfügt und zu beliebigen Zeitpunkten abgerufen, d.h. für ein situationsangepasstes Verhalten verfügbar gemacht werden kann. (Rainer Sinz) Forscher um die Neuropsychologin Angela Friederici spielten den deutschen Babys italienische Sätze vor. Wie Messungen mit dem Elektroenzephalografen (EEG) zeigten, speicherten die Säuglinge innerhalb einer knappen Viertelstunde Abhängigkeiten zwischen verschiedenen sprachlichen Elementen in den Sätzen ab. (SPIEGEL) Nicht allein der Vorgang der Verschriftlichung bringt Abweichungen mit sich, die aktuelle Psychologie und Hirnforschung lehren uns vielmehr, dass unser episodisches Gedächtnis kein simpler Datenspeicher ist! Da werden Informationen schon beim Speichern mit altbekannten Inhalten verknüpft, und jedes Abrufen geht mit einem anschließenden Neuspeichern einher. (Johannes Fried, Historiker) „Argumentstrukturen“ sollen im „mentalen Lexikon gespeichert werden“ (Angelika Wöllstein-Leisten u. a.: Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse. Tübingen 1997:95) „Im Gehirn sind alles Wissen und auch die Programme, nach denen dieses Wissen verwertet wird, in der Verschaltung der Nervenzellen gespeichert.“ (Wolf Singer in FAZ 17.9.14) Die Bibliothek in meinem Kopf: Wie sind Wörter im Gehirn gespeichert? (https://www.mpib-berlin.mpg.de/de/presse/2014/09/die-bibliothek-in-meinem-kopf-wie-sind-woerter-im-gehirn-gespeichert) Nomen und Verben werden in unterschiedlichen Regionen des menschlichen Gehirns gespeichert. (Bild der Wissenschaft 17.1.06) „Im mentalen Lexikon gibt es jeweils ein eigenes Speichersystem für die Wortformen und die Wortbedeutungen.“ (Volker Harm: Einführung in die Lexikologie. Darmstadt 2015:111) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 09.26 Uhr |
|
Wie war das noch mal mit dem Speicher für Gerüche? Die Frage ist unbeantwortet. Einfach nur zu sagen: "Wir erkennen Gerüche wieder, also müssen sie gespeichert sein" – das genügt ja wohl nicht; man spricht damit nur die Wiederkennbarkeit noch einmal aus. (Sind Proben gespeichert wie in den Flaschen der Stasi, und wer vergleicht sie mit Beispielen?) Sollte Speichern nicht etwas Spezifischeres bedeuten als die selbstverständliche Veränderung des Organismus durch Lernen? Wenn nicht, dann ist es mir auch egal, dann ist es eben ein Synonym für Erinnern, Gelernthaben usw. (Das entspricht dann aber auch nicht den ausgearbeiteten Speichermodellen, die ja etwas erklären sollen.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.03.2018 um 08.49 Uhr |
|
Die volkstümliche Rede vom "Kramen in Erinnerungen" hat nichts mit einer halbwegs wissenschaftlichen Psychologie zu tun, die doch subpersonal die wirklichen Vorgänge und nicht deren metaphorische Darstellung betreffen sollte. Daher auch erst die Ablehnung eines Homunkulus, also einer Person der Person (usw.). Die Suche nach einem Wort müßte um so länger dauern, je mehr Wörter einer gelernt hat. Das Gegenteil ist der Fall, die Kinder werden älter und immer eloquenter. Ich verstehe auf Anhieb vielleicht 500.000 Wörter ohne Wörterbuch, aber sollte ich in einem mentalen Lexikon nachschlagen? In Echtzeit?? Und dann soll es ja auch noch ein Lexikon mit "Bedeutungen" geben... |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.03.2018 um 18.22 Uhr |
|
"Je mehr gespeichert ist, desto länger müßte die Suche dauern" Wieso "müßte", dauert es denn nicht länger? Wer hat das je genau gemessen? Wieviel Erinnerungsplatz belegen 100 Stunden Musik? Ist das viel oder wenig? "wer sucht da eigentlich usw.? Doch nicht der Pianist/der Sprecher" Ja, wieso denn nicht? Wer sonst? Natürlich kramt jeder selbst in seinen Erinnerungen. Ich verstehe nicht, wie man überhaupt auf die Idee einer Art inneren "Homunkulus" kommen kann. "Ich" fühle mich selbst, bin mir meiner selbst bewußt. Meine Gedanken, Erinnerungen, das bin "ich" selbst. Bei allen diesen Fragen geht es doch nur(!) um die ganz spezielle Art und Weise, die Organisation und die Abrufbarkeit der gepeicherten Information, was im Moment noch niemand beantworten kann. Angeblich gibt es ein Speicherparadox, aber niemand hat es je genau vermessen. Wieviel Zeit benötigen ein einsprachiger Schulanfänger und ein zehnsprachiger Berufsdolmetscher zur Erinnerung an das Wort Waldmeisterlimonade? Vielleicht beide viel weniger, als zum Sprechen in Echtzeit nötig wäre? Keiner weiß es, also weiß niemand, ob das Paradox überhaupt existiert. Also widerlegen all diese Fragen auch nicht die Existenz eines mentalen Speichers. Immer wieder sage ich, es "muß" gespeichert sein. Na ja, wenn ich bei jmd. zum Kaffee eingeladen bin und der Gastgeber sagt, bitte nimm dir Zucker und Sahne, dann denke ich halt, irgendwo "muß" er doch doch die Sachen stehen haben, und fühle mich irritiert, wenn er dann sagt, nein, er hat nirgends Zucker oder Sahne gespeichert. Also gibt es bei ihm nichts dergleichen. Dasselbe ist es doch, wenn der Mensch kein Wissen gespeichert hat. Dann weiß er eben nichts. Die Frage, woher weißt du, wie die zweite Klaviersonate von Beethoven beginnt, ist sinnlos. Barenboim weiß es nicht. Trotzdem kann er sie spielen. Die Noten fliegen ihm aus der Luft zu. Er hat gelernt, sich so zu verhalten, daß ihm die Noten von allein aus der Luft zufliegen. Was ist also mit der These vom mentalen Speicher gewonnen? Ja, sie erklärt doch immerhin, daß ein sinnvolles menschliches Verhalten nicht völlig aus der Luft gegriffen sein muß. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2018 um 16.40 Uhr |
|
„Bei den Techniken des Erinnerns geht es nicht darum, das Gedächtnis wie ein Lagerhaus zu durchsuchen, sondern um eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Reaktionen.“ (Skinner: Was ist Behaviorismus? 126) Eine Möglichkeit wäre das inkrementelle Modell (wenn auch nicht behavioristisch, denn der radikale Behaviorismus interessiert sich nicht für das Innere der Blackbox): http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1642#38008 und folgende Einträge, auch zum genannten Vokabelparadox. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2018 um 16.24 Uhr |
|
Lieber Herr Riemer, immer wieder kommen Sie auf "muß" (gespeichert sein) – also genau das, was bezweifelt wird. Das macht es für mich etwas schwierig. Zu den Schwierigkeiten mit dem Speichern gehört das von mir oft erwähnte Paradox: Je mehr gespeichert ist, desto länger müßte die Suche dauern (abgesehen davon, daß wir nicht die geringste Vorstellung von diesem Suchverhalten haben: wer sucht da eigentlich usw.? Doch nicht der Pianist/der Sprecher usw. Also ein Homunkulus?) Ein Pianist soll bescheidene 100 Stunden Musik "gespeichert" haben. Wie findet er (wer?) einen bestimmten Takt? |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 14.03.2018 um 15.13 Uhr |
|
Was macht es grundsätzlich für einen Unterschied, ob man sich von einer Klaviersonate die Notenwerte oder den Klang (Melodie, Rhythmus usw.) oder den mechanischen Bewegungsablauf beim Tastenspiel merkt, d. h. im Kopf abspeichert? Ich nehme an, es ist oft eine Mischung von allem, vielleicht kommen auch visuelle Merkhilfen dazu, außerdem ein Sinn, d.h. die innere Logik des Stückes, eine Geschichte, anhand der das ganze Klavierstück einen Zusammenhang erhält. Dazu kommen noch lang eingeübte allgemeine Bewegungsreflexe, die Fingerfertigkeit. Wie auch immer, was auch immer, in irgendeiner Form mußte Barenboim alles (einschl. der Reflexe) in sich abgespeichert haben. Ohne einen abrufbaren Speicher funktionieren nicht einmal die niedrigsten Reflexe kleiner Insekten. Wo sollte es sonst herkommen? Man muß natürlich den Speicher entsprechend weit fassen. Man könnte z. B. behaupten, eine Modellbahnanlage hätte gar keinen Speicher für die Koordinaten einer Kreisbewegung, der Zug führe von ganz allein immer im gleichen Kreis herum. Aber die Schienen sind fest verlegt, sie bilden sozusagen den Speicher für jede möglichen Bewegung des Zuges. Könnten Sie mir, lieber Prof. Ickler, noch einmal helfen, welche begrifflichen und empirischen Bedenken es dagegen gibt, daß Lebewesen zur Steuerung ihres eigenen Verhaltens auf gespeicherte Information zurückgreifen? Wo haben Sie solche Bedenken schon konkret erwähnt? Mir erscheint das nicht bedenklich, sondern geradezu folgerichtig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.03.2018 um 11.43 Uhr |
|
Um nur noch ein Beispiel zu nennen: Der Pianist Daniel Barenboim hat vor einiger Zeit alle 32 Klaviersonaten Beethovens an acht Abenden innerhalb von zwei Wochen vorgetragenn, alle auswendig. Die hat er also alle "gespeichert". (Und das war nur ein Teil seines Repertoires.) Aber was ist mit einer solchen These gewonnen, wenn wir nicht die leiseste Ahnung haben, wie es funktioniert, dagegen sehr wohl begriffliche und empirische Bedenken? Ich nehme an, daß Musiker so ähnlich wie Schachspieler arbeiten, die nach einem kurzen Blick den Stand einer Partie erfassen und noch Wochen später nachstellen können. Sie sehen eben nicht nur, sondern verstehen den "Sinn". Auch das Sprechen ist eine Mischung aus Fertig- und Halbfertigteilen (pre-fabs) und spontan Erzeugtem. Gieseking war der Meinung, man brauche gar nicht zu üben, sondern nur die Noten zu studieren (Methode Gieseking-Leimer). Dazu überlegt sich der Pianist an einigen Stellen einen Fingersatz, und dann kann er das Stück spielen, aus dem Stand sozusagen, wie wir ja auch etwas aus dem Stand erzählen können. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.02.2018 um 05.13 Uhr |
|
„Außerdem können Trachtbienen ein horizontales Zielobjekt auch aus einer neuen Richtung erkennen, eine Eigenschaft, die die Fähigkeit voraussetzt, eine zweidimensionale Figur im Geist drehen zu können.“ (Gould, James L./Gould, Carol Grant (1997): Bewußtsein bei Tieren. Heidelberg u. a.:110) Der ganz unklare, physiologisch bisher nicht sinnvoll interpretierte Begriff der "mentalen Rotation" wird hier unnötigerweise auf das Verhalten von Insekten angewendet. (Das Buch ist wertlos.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.02.2018 um 16.28 Uhr |
|
Schon Lashley hat den Fehler der fehlplazierten Wiederholung einbezogen, z. B. beim Tippen: suuper statt supper. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1608#34911 „This organization could not be attributed to moment by moment responding to a serially ordered environment, but rather depends upon internal organizing principles by which the animal controls its own behaviour.“ (Houghton über Lashley) Aber wer steuert hier wen, und ist das nicht auch ein erklärungsbedürftiges Verhalten? Jedenfalls das Homunkulusmodell, das nicht von der Annahme eines Agens innerhalb des Organismus loskommt. "Mind is back!" – leider. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.09.2017 um 09.17 Uhr |
|
Zu den Speichermodellen der "Kognitionspsychologie" hat Skinner sehr scharfsinnig bemerkt: Storage and retrieval become much more complicated when we learn and recall how something is done. It is easy to make copies of things we see, but how can we make copies of the things we do? We can model behaviour for someone to imitate, but a model cannot be stored. The traditional solution is to go digital. We say the organism learns and stores rules. When, for example, a hungry rat presses a lever and receives food and the rate of pressing immediately increases, cognitive psychologists want to say that the rat has learned a rule. It now knows and can remember that "pressing the lever produces food." But "pressing the lever produces food" is our description of the contingencies we have built into the apparatus. We have no reason to suppose that the rat formulates and stores such a description. The contingencies change the rat, which then survives as a changed rat. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.05.2016 um 17.46 Uhr |
|
Zur Ansetzung von "mental imagery": Imagery is known to exist inasmuch as the explanations that rely upon imaginal representations are known to be true. (Nigel Thomas) So einfach ist das nicht. Man braucht erstens ein Kriterium der "Wahrheit", sonst könnten auch mythologische Erklärungen angenommen werden, mit allen Folgen. Etwas anderes ist es mit Voraussagen, wie man sie z. B. mit der Annahme mentaler Rotation gemacht und teilweise auch bestätigt hat (weniger als gedacht, aber das ist ein anderes Thema). Insofern ist mentale Rotation immerhin ein nützliches Konstrukt. Aber auch das schließt nicht die Existenz ein. Hierzu das Planimeter-Argument und die Wüstenameisen. Auch wenn es eine erfolgreiche Annahme ist, daß die Planimeter und Wüstenameisen Integralrechnung treiben, so wissen wir doch absolut sicher, daß sie es in Wirklichkeit nicht tun. Die Homunkulusmodelle (zu denen sie gehören) sind in Grenzen erfolgreich – deshalb haben wir sie ja erfunden. Aber "wahr" sind sie trotzdem nicht. Anderswo habe ich schon mal das Problem der Rekonstruktion des Indogermanischen angesprochen. Selbst wenn es nützlich (erfolgreich) sein sollte, mit einer hypothetischen Sprache zu arbeiten, die nur einen Vokal, aber 12 Laryngale enthält, ist es höchstwahrscheinlich irreal, nämlich physisch und typologisch unmöglich. Das alles bedeutet, daß man nach alternativen "Erklärungen" suchen kann und auch sollte, die eine realistische Deutung zulassen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.01.2016 um 04.18 Uhr |
|
Zu Lashleys Problem (http://www.sprachforschung.org/ickler/?show=news&id=1616) gibt es hier einen allgemeinverständlichen Beitrag, der auch für Sprache relevant ist: http://de.in-mind.org/article/bitte-draengeln-dann-geht-alles-schoen-der-reihe-nach-wie-wir-reihenfolgen-abspeichern-und Lashleys klassischer Aufsatz stand auch Pate bei der Entstehung der generativen Grammatik mit ihren weitreichenden Folgerungen und Folgen. Außer Experimenten kann auch die Untersuchung von "Verleistungen" (Versprechen, Vertippen usw.) dazu beitragen, das Erzeugen von Reihenfolgen zu erklären. Die physiologische Ebene ist noch nicht erreicht, kann nur im Modell plausibel gemacht werden. Gaschlers weitere Arbeiten sind auf seiner Homepage verlinkt – lesenswert! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.07.2014 um 11.42 Uhr |
|
"Vom Gehirn kann gesagt werden, es repräsentiere einen Umgebungsaspekt, wenn eine formale Korrespondenz (Isomorphiebeziehung) zwischen dem Umgebungsaspekt und einem Teil derjenigen Gehirnprozesse besteht, die das Verhalten des Organismus an diesen anpassen." (Krist/Wilkening in Sprache & Kognition 10,4,1991:182) Zwischen einem Rezept und dem Kuchen, der danach gebacken wird, besteht keinerlei Isomorphie. Der ganze Ansatz ist falsch. Variationen des zitierten Satzes findet man buchstäblich überall in der mentalistischen Literatur ("Kognitive Psychologie/Linguistik"). Der Schaden ist enorm. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.06.2014 um 04.26 Uhr |
|
Dabei senden die Tiere Schallwellen aus, die von der Umgebung reflektiert werden. Wenn das Echo wieder aufgenommen wird, zeichnet das Gehirn ein Bild der Umgebung. (WamS 16.3.14 über Wale) Das Gehirn zeichnet kein Bild der Umgebung. "Bilder" gehören in den Geist, nicht ins Gehirn, Der Geist ist ein folkpsychologisches Konstrukt, in das man hineinkonstruieren kann, was man für richtig hält. Das Gehirn ist ein realer Gegenstand, und wir wissen genug von ihm, um "Bilder" nicht für etwas zu halten, wonach man darin suchen kann. In der Diskussion über Bilder (Imagery) wird übrigens fast nur von visueller Wahrnehmung und Erinnerung gesprochen, schon das Akustische ist vernachlässigt, erst recht Geruchsempfindungen u. a. Wie soll man sich die "Repräsentation" des Geruchs frischer Gurkenscheiben vorstellen - und dazu die Unterscheidung von Erdbeeren usw.? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2014 um 16.37 Uhr |
|
Die Diskussion läuft ein bißchen am Kern der Sache vorbei. Vielleicht sollte man noch einmal einen Blick auf Dawkins' Texte werfen, besonders die Frage der Reversibilität. Die Vokabeln, die Klaviersonaten usw., die man hervorbringen kann, sind nicht "im Kopf". Dort hat sich durch das Lernen etwas verändert, und zwar so, daß das Gehirn unter geeigneten Bedingungen (wozu auch die "Hardware" Körper gehört) ein bestimmtes Verhalten steuert. In gewisser Hinsicht kann der Organismus sich so verhalten, "als ob" in ihm ein Lexikon, eine Partitur, eine Bildersammlung wären. Das ist der Grund, warum man solche mentalistischen Konstrukte überhaupt entwickelt oder erfunden hat. Platon versucht ja (ergebnislos), mit Gedächtnismodellen wie Wachstafel oder Taubenschlag zu experimentieren. Ich hatte schon mal - um ein einziges Beispiel zu geben - auf das Vokabelparadox hingewiesen: Je mehr Wörter man kennt, desto länger müßte das innere "Nachschlagen" dauern, also: je größer der Wortschatz, desto schwerer die Wortfindung. Es ist aber eher umgekehrt. Grundsätzlicher und mit Lashley: Speichermodelle sind gut und schön, aber das Problem des Ablesens oder Auslesens des Gespeicherten ist völlig ungelöst. (Zumal im Gehirn Arbeitsspeicher und Massenspeicher nicht getrennt sind.) Dawkins (Genetik) und Skinner (Konditionierung) verwerfen das Speichermodell gleich ganz und entwerfen eine begrifflich ganz andere Denkmöglichkeit. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 19.06.2014 um 16.21 Uhr |
|
Aber warum benutzt man denn überhaupt Bilder? Doch wohl darum, um einen Sachverhalt mittels der Bilder leichter verstehen zu können. Ihn sich also erklären zu können. Und wenn ich ganz genau sein will, bilde ich mir damit natürlich nur ein, etwas erklären zu können. Wie soll man bitte mit Bildern arbeiten und sich nicht einbilden, "irgendetwas erklärt zu haben"? |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 19.06.2014 um 16.03 Uhr |
|
Ob Rezept, Blaupause oder Lexikon: das sind alles angenäherte Bilder für etwas, daß sonst nur schwer darzustellen ist. Solange diese Bilder nicht geeignet sind, völlig in die Irre zu führen - was spricht denn dagegen? Wenn ich ein neue Vokabel gelernt habe, hat sich doch in meinem Gehirn etwas geändert, vermutlich durch neue Verknüpfungen bestimmter Neuronen. Jedenfalls ist diese neue Vokabel nun "in meinem Gehirn" drin, so wie früher gelernte Vokabeln. Warum sollte man das nicht als "Lexikon im Gehirn" beschreiben? Ich sehe darin keinen Schaden, solange man sich nicht einbildet, mit solchen Bildern irgendetwas erklärt zu haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.06.2014 um 04.12 Uhr |
|
Gerade "Bezug", "Sichbeziehen" sind Begriffe, mit denen eine naturalistische Darstellung nichts anfangen kann. Es ist aber nicht ganz einfach, sich dem Zwang der üblichen mentalistischen Redeweise zu entziehen.
|
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 18.06.2014 um 23.24 Uhr |
|
Die Frage ist, ob man sich dem Konzept der Repräsentation überhaupt entziehen kann. Es handelt sich dabei weniger um einen Begriff als um ein fundamentales Schema, wie immer auch die Philosophen es umschrieben haben (als frühes Beispiel am bekanntesten das Höhlengleichnis): Da ist etwas, das seine Geltung aus seinem Bezug auf ein anderes schöpft. Soweit – und nur dann kann man darüber reden – dieses Etwas als Aussage begegnet, muß sie wahr oder falsch, zur Sache oder daneben usw. sein: also immer bezogen auf ein Anderes. Selbst Aussagen, die ihre Geltung aus sich selbst zu schöpfen scheinen ("Wahrlich, ich sage euch..."), spielen mit dem Schema der Repräsentation, setzen es beim Zuhörer voraus. Das Wort ist dann halt z.B. das Wort Gottes, das der Sprecher zu präsentieren vorgibt. Eine Aussage ohne jeden Bezug auf etwas anderes wäre gar nicht als solche identifizierbar, sondern bloßes Geräusch. Das kann man zugeben, ohne darauf verzichten zu müssen, die Idee von Blaupausen oder auch Rezepten zu verwerfen. Sie läßt sich auch als Repräsentation einer weitverbreiteten ontologischen Verirrung verstehen, nämlich einer teleologischen Deutung der Welt. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 18.06.2014 um 13.15 Uhr |
|
Für den Hausbau braucht man außer den Bauplänen, die das fertige Werk darstellen, auch Leistungsbeschreibungen für die Handwerker, die die zu verwendenden Materialien und die Art der Ausführung enthalten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 18.06.2014 um 11.53 Uhr |
|
Man darf das Bild nicht überstrapazieren, vor allem nicht diejenigen Bestandteile, die für den Vergleich nicht wesentlich sind. Nehmen Sie statt Rezept ein Programm, z. B. auf Lochstreifen, das aber nicht starr abgearbeitet wird (von NIEMANDEM übrigens, weil es Teil des Apparates ist), sondern vor jedem Schritt eine Rückmeldug vom bisher Bewirkten erhält. Baupläne oder "mentale Landkarten" usw. sind scheinbar vertraut, aber damit erklärt man nichts. Als Personen wissen wir nur zu gut, wie man Landkarten oder Stadtpläne benutzt, aber wer so etwas im Gehirn lesen und nutzen soll, ist völlig unklar. Im Gegenteil, die Forschung nimmt fast ausnahmslos an, daß es keinen Homunkulus gibt, der die mentalen Karten liest, im mentalen Lexikon nachschlägt usw. Das beeinträchtigt die anfängliche Plausibilität von Blaupausen und anderen "Repräsentationen" doch ganz beträchtlich. Was wäre denn erklärt, wenn man annähme, die Ratte hätte eine "Landkarte" des Labyrinths im Kopf ausgebildet? Vorstellen kann man sich nichts darunter. Sie verhält sich eben einfach so wie ein Mensch, der in einem solchen Falle eine Landkarte benutzen würde. Aber wir wissen doch, daß es nicht entferntesten so zugehen kann. (Wir hatten das schon mal bei der Orientierung der Wüstenameisen.) Mir geht es letzten Endes natürlich darum, daß das Sprachverhalten ohne die heute allgegenwärtige Annahme von gespeicherten Regeln, gespeichertem "mentalen Lexikon" usw. erklärt werden kann. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 18.06.2014 um 11.40 Uhr |
|
Ein Rezept verlangt in der Regel nach einem Koch, einer zentralen Instanz, welche die Vorgaben interpretiert und umsetzt. Ein Bauplan wird hingegen an viele Handwerker gegeben, die dann jeweils ihre Teilaufgaben erledigen. Insofern paßt das Bild besser.
|
