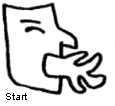


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
10.11.2015
Der False-belief-Test
Fragwürdiges Verfahren der mentalistischen Psychologie
In fast allen Arbeiten zur „Theorie des Geistes“ spielt der „False-belief-Test“ eine entscheidende Rolle. Er wurde, nach einer Anregung Daniel Dennetts, 1983 von Heinz Wimmer und Josef Perner vorgestellt („Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception“. Cognition 13, 1983:103-128).
Eine der vielen Darstellungen findet sich bei Wikipedia („Theory of mind“):
Vor dem Kind liegt eine Keksdose. Das Kind wird gefragt, was sich vermutlich darin befindet (zu erwartende Antwort: „Kekse“). Die Schachtel wird geöffnet - darin befinden sich jedoch keine Kekse, sondern etwas Unerwartetes (z. B. Buntstifte). Nun wird das Kind gefragt, was wohl eine andere Person in dieser Dose vermuten wird. Kinder, die noch keine Theory of Mind entwickelt haben, werden „Buntstifte“ antworten, weil sie noch nicht verstehen, dass andere Personen eine falsche Überzeugung über einen Sachverhalt haben können. ToM-fähige Kinder sagen hingegen „Kekse“. Interessanterweise haben die Kinder dabei nicht nur Schwierigkeiten zu verstehen, dass andere Personen eine falsche Überzeugung haben können, sondern auch, dass sie selbst eine falsche Überzeugung hatten und vorher dachten, dass in der Schachtel Kekse sind.
Das Bestehen des Tests gilt als Beweis dafür, daß das Kind eine „Theory of Mind“ (ToM) ausgebildet hat, d. h. die Zuschreibung geistiger oder „mentaler“ Vorgänge bei anderen. „The standard interpretation of the failure on false belief tasks is that children lack a ToM or, 'in more colorful words, cannot read other peoples’ minds' (Salzinger, 2006)“. (Schlinger) Ob es sich dabei um etwas Theorieähnliches handelt oder eine andersartige „Versetzung“, „Perspektivenübernahme“ oder „Simulation“, ist umstritten, soll hier aber nicht diskutiert werden.
Das mentale Leben des anderen besteht mindestens aus Denken und Wollen („Intentionalität“), vielleicht noch Fühlen.
Allgemeiner läßt sich diese Auffassung so umschreiben: Das Kind entwickelt eine Art von „Psychologie“, ohne die es das Verhalten anderer nicht verstehen und sich in seinem Verhalten nicht darauf einstellen könnte.
Eine naheliegende Kritik hebt die Sprachlastigkeit des Tests hervor und wirft die Frage auf, ob und wie die Kinder die Aufgabenstellung überhaupt verstehen.
Es ist z. B. möglich, daß der kindliche Begriff von „suchen“ ein anderer als der erwachsenensprachliche ist. Die kleineren Kinder könnten darunter so etwas wie „erfolgreich suchen“ verstehen.
Möglicherweise verstehen die Kinder auch werden oder wollen als sollen o. ä. Bisher scheint nicht durch gesonderte Experimente sichergestellt zu sein, daß die Kinder die Wörter in genau demselben Sinn verstehen wie die untersuchenden Wissenschaftler.
Das Kind ist verschiedenen Reizen ausgesetzt, vor allem der gezeigten Episode und dem sprachlichen Reiz der Aufgabenstellung. Nach Schlinger und anderen Behavioristen reagiert das Kind je nach Lebensalter und Aufmerksamkeitsspanne teilweise stärker auf die Situation als auf die Fragestellung. Auch spielt die Zeit eine Rolle, die zwischen dem Manipulieren der Gegenstände und der Frage vergeht. Schlinger zitiert auch Studien, wonach die Formulierung der Aufgabe Einfluß auf die Antwort des Kindes hat. Außerdem hängt es davon ab, wieviel Erfahrung das Kind in der Familie mit ähnlichen Aufgaben bereits hat. Schlinger verbindet den Test mit den Entwicklungsstadien nach Piaget. Auch das Kind selbst sucht in frühen Phasen einen Gegenstand dort, wo er gewöhnlich ist, obwohl es gesehen hat, daß sein Ort verändert worden ist.
In einigen Varianten wird dem Kind die Testfrage als irrealer Konditionalsatz vorgelegt. Das ist die schwierigste, von Kindern zuletzt erworbene Satzkonstruktion, mit der sich auch Erwachsene schwertun.
Ähnliche Bedenken bestehen gegen kulturvergleichende Untersuchungen, weil die Aufgabenstellung in sehr verschiedenen folkpsychologischen Systemen möglicherweise anders verstanden wird.
Andere Psychologen haben gefunden, daß schon viel jüngere Kinder ein Verständnis für False beliefs zeigen, vor allem wenn man den Test weniger sprachlastig anlegt. Dann schneiden schon 2½jährige recht gut ab.
„Contrary to traditional claims, the ability to attribute false beliefs to others is already present by the second year of life.“ (Renée Baillargeon/Rose M. Scott/Zijing He: „False-belief understanding in infants“. Trends in Cognitive Sciences 14/3, 2010:110-118, S. 116) Auch Birch und Bloom haben zeigen können, daß Kinder die Täuschung anderer schon viel früher beherrschen.
Alle Verstellungsspiele beruhen ja darauf, daß man dem anderen eine falsche „Vorstellung“ vermittelt; es ist also derselbe Mechanismus wie beim False-belief-Test. Das Verstellungsspiel ist in natürlicher Umgebung leichter zu beobachten als die etwas künstlichen Bedingungen des Tests.
Nach Nichols und Stich verstehen die Kinder das Verstellungsspiel (Pretending) zwei Jahre früher, als sie den False-belief-Test bestehen.
Nach Hildegard Hetzer (Die symbolische Darstellung in der frühen Kindheit. Wien 1926:22) ist ein Knabe mit 1;5 schon imstande, ein "Tun-als-Ob" des Erwachsenen zu verstehen. Das Kind benutzt sehr früh seinen eigenen Körper und jeden beliebigen Gegenstand durch phantasievolle Umdeutung als Darstellungsmittel. Nach Bruners Beobachtung tritt das Versteckspiel (mit der Mutter) schon im ersten Lebensjahr auf.
Unsere Tochter Johanna (1;7) spielt mit einer blauen Plüschmaus, wirft sie hinter sich, bewegt den Kopf übertrieben hin und her, als suche sie danach, „entdeckt“ sie und krabbelt hin. Dabei ruft sie Maus oder Da-isse Maus.
Auf der anderen Seite hat man festgestellt, daß auch Erwachsene bei vergleichbaren Aufgaben unter gewissen Umständen versagen. Überhaupt scheint „Mindreading“ nicht so erfolgreich zu sein, wie der Laie sich einbildet.
Die naturalistische Rekonstruktion von Verstellungsspielen geht nur von den Beobachtungsdaten aus, die auch dem Kind zugänglich sind. Bei Verstellungsspielen werden Signale wie Lachen ausgetauscht, die „nicht ernst“ anzeigen. Tiere begleiten das Spiel manchmal mit einem „Spielgesicht“; bei Hunden etwa deutet die ganze Körperhaltung an, daß sie spielen wollen (= daß Spielen in diesem Augenblick verstärkend wirkt) (www.zooschule-landau.de). Sozial lebende Tiere wie Hunde oder Affen scheinen mehr solche Spiele zu haben als andere, behalten sie auch über die Kindheit hinaus länger bei.
(Weiteres unter „Vormachen und Nachahmen“)
| Kommentare zu »Der False-belief-Test« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.11.2024 um 07.09 Uhr |
|
Zum Priming-Effekt auf Hörerseite paßt ein alter Witz, den auch Hans Maier in einem Vortrag mal (umständlicher als hier) wiedergegeben hat: „Was machen Sie denn als Zirkuskünstler?“ – „Ich zersäge Frauen.“ – „Haben Sie Familie?“ – „Ja, zwei Halbschwestern.“ |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.10.2024 um 05.26 Uhr |
|
In der längst überfälligen „Replikationskrise“ der Psychologie spielt der Priming-Effekt eine herausragende Rolle. Auch durch Kahnemans Bestseller ist die Diskussion belebt worden. Manche Experimente fielen durch ihre Realitätsferne und die Vagheit der zugrunde liegenden Begriffe auf. Ob jemand nach Lektüre religiöser Texte in Fragebogentests prosozialer reagiert (also ein besserer Mensch geworden zu sein scheint), ist wohl keine besonders sinnvolle Frage. Wir sind in der Forschung zu sprachlichen „Verleistungen“ auf lebensechte Priming-Effekte gestoßen (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1647#30572). In Skinners „Verbal behavior“ gibt es auch Beispiele (S. 43). Lesenswert: https://replicationindex.com/2017/02/02/reconstruction-of-a-train-wreck-how-priming-research-went-of-the-rails/ https://replicationindex.com/2020/12/30/a-meta-scientific-perspective-on-thinking-fast-and-slow/ https://replicationindex.com/2017/02/02/reconstruction-of-a-train-wreck-how-priming-research-went-of-the-rails/comment-page-1/#comment-1454 |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.05.2024 um 16.09 Uhr |
|
Anlieger bis Baustelle frei Man könnte diese Mitteilung als elliptischen Satz auffassen und eine vollständige Aussage rekonstruieren, aus der die Verkehrsteilnehmer dann ihre praktischen Folgerungen ableiten könnten. Verkehrszeichen sind jedoch ihrer Funktion nach keine Beschreibungen (Takts, nach Skinner), sondern appellativ (Mands), und so werden sie aufgenommen. In diesem Fall ist „bis Baustelle frei“ eine Beschränkung der Sperre (die durch ein zweites Schild angeordnet wird), also eine „Freigabe“, die ihrerseits konditionalisiert wird. Man könnte paraphrasieren: „Wenn Sie Anlieger sind, dürfen Sie bis zur Baustelle weiterfahren.“ Der Fall ist also ähnlich wie das von Skinner analysierte: „Hansi, steh auf!“ (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1647#38498) Es ist aber nicht nötig, die explizite Formulierung als Ausgangspunkt anzusetzen und mit dem Ellipsenbegriff zu arbeiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2024 um 04.32 Uhr |
|
Noch zu Herrn Riemer: sagen ist versteckt mentalistisch. Das zeigt der Inhaltssatz, der davon abhängig ist. Sprachverhalten so zu beschreiben, daß es keinen „Inhalt“ hat, keine „Intentionalität“ im phänomenologischen Sinn von „Sich-Beziehen“, ist nicht leicht. Skinners „Verbal behavior“ ist der bisher umfassendste Versuch. (Zur Erinnerung: "Bedeutung ist ein Surrogat für Geschichte.") |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2024 um 04.10 Uhr |
|
Bei vielen Tierarten ist es so, daß jeder dem anderen einen Leckerbissen wegzuschnappen versucht. So etwa bei den Möwen. Von Kooperation keine Spur; wir Menschen sehen es mit Kopfschütteln, weil wir uns denken, anders wäre es besser, aber das ist natürlich naiv und unbiologisch gedacht. Anders dagegen bei Katzen, denen ich oft zugesehen habe: Wenn der Kater etwa ein Jungkaninchen erbeutet hatte, verzehrte er es im Hausflur, während seine gleichaltrige Schwester danebensaß und zuschaute, allerdings nicht sehr gierig, sondern halb schläfrig. Wenn er fertig war, ging er davon, und sie machte sich über die Reste her. (Man könnte sagen: Sie wußte, daß sie ihren Anteil bekommen würde, aber das ist überflüssig und ändert nichts. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1240#49379) Kein rangniedriger Affe wird versuchen, einem höheren etwas wegzunehmen, es sei denn mit List. Dieses Spiel beschäftigt die Affen den ganzen Tag. Oft artet es auch in lautstarke Massenschlägerei aus, wie von Musil beschrieben. Man muß diese Unterschiede beachten, wenn man über Verteilung zwischen Tieren berichtet. Die Unterbringung zweier Äffchen in getrennten Plexiglaskäfigen, wo sie einander sehen, aber nicht interagieren können, ist völlig unnatürlich und schneidet das angeborene Verhalten bis zur Unkenntlichkeit ab. Frans de Waal hat jahrzehntelang naive und irreführende Ansichten über Tiere und Menschen popularisiert, u. a. in nicht weniger als 16 Büchern dieser Art. Gut fürs Feuilleton, schlecht für die Wissenschaft. Das müssen nicht nur Behavioristen so sehen, sondern auch Evolutionsbiologen wie Dawkins und klassische Ethologen der Tinbergen/Lorenz-Schule. Manche fordern mit Recht, nicht nur Tiere, sondern auch den Menschen zu entanthropomorphisieren, so paradox das auch klingt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.03.2024 um 03.56 Uhr |
|
Sicher nicht. Die Menschheit (oder ein Teil davon) ist erst sehr spät darauf gekommen, eine metaphorische (eigentlich transgressive) Redeweise zu entwickeln, in der es eine Innenwelt (den "Kopf", das "Herz" usw. im nichtanatomischen Sinn) gibt. Die Ethnopsychologie zeigt noch heute große Unterschiede zwischen den Verständigungstechniken einzelner Völker. Bruno Snell titelt zwar "Die Entdeckung des Geistes", läßt aber keinen Zweifel, daß es sich mehr um eine Konstruktion als eine Entdeckung handelte. Das habe ich anderswo schon zitiert. Wir sind so tief drin, daß wir uns gar nicht vorstellen können, wie spezifisch und wie jung unsere psychologischen Begriffe sind. Ich sage übrigens nie "eingeflüstert", das gäbe einen falschen Eindruck, sondern spreche von "Hineinreden" im Sinne der sprachlichen Sozialisation. Denken, glauben, wollen fallen nicht vom Himmel. Das Experimentum crucis ist leider nicht möglich, weil es keine Wolfskinder und keinen "Kaspar Hauser" gibt und geben kann (der historische war keiner). |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 20.03.2024 um 02.38 Uhr |
|
Man könnte versuchen, in der Frage alle mentalen Ausdrücke zu vermeiden, etwa so: Was wird nun die andere Person sagen, daß in der Dose ist? Es will mir nicht so recht einleuchten, daß es sich bei "glauben/vermuten" nur um eine Verständigungstechnik handelt, die dem Kind von außen eingeflüstert wird. Wird es nicht von einem gewissen Alter an bemerken, daß auch andere, so wie es selbst, eine Kopfarbeit leisten, daß sie vielleicht dabei auch zögern, sich auch irren können? Angenommen, man könnte dem Kind bis dahin die Wörter "glauben/vermuten/denken" usw. vorenthalten, würde es nicht mit der Zeit von selbst bemerken, daß auch andere Personen ein dem Kind unzugängliches Innenleben, Gefühle usw. haben? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 19.03.2024 um 19.03 Uhr |
|
Noch einmal zum False-belief-Test: In der Versuchsanordnung ist notwendigerweise ein Satz enthalten, der in der zitierten Fassung so lautet: „Nun wird das Kind gefragt, was wohl eine andere Person in dieser Dose vermuten wird.“ Das gibt sich harmlos genug, aber damit wird bereits eine bestimmte Psychologie, eben die Theorie des Geistes, in das Kind hineingeredet. Noch klarer zeigt es die äquivalente Formulierung: „Was glaubst du, daß die andere Person glauben wird?“ So etwas entwickelt sich nicht im Kind, sondern stammt aus der gesellschaftlichen Umgebung. Der Test stellt also eigentlich fest, wie weit das Kind diese Verständigungstechnik bereits übernommen hat. Das ist zwar interessant, aber es ist nicht das, was die Kognitionspsychologen zu untersuchen glauben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.09.2022 um 07.12 Uhr |
|
There are plenty of signs that even before their second birthday, children have some appreciation of the workings of other minds. (Paul Bloom/Tim P. German: Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory of mind. Cognition, 77, 2000:B25–B32; B29) www.yale.edu/minddevlab/papers/false.belief.pdf) Die Kritik an der falschen Datierung ist berechtigt, nicht aber die ganze Darstellung mit unnötigen Begriffen wie "other minds", die dem Kleinkind eine Theorie unterstellt, wo es einfach um gelerntes Verhalten geht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.08.2019 um 03.50 Uhr |
|
Manche Kinder drehen schon mit 18 Monaten ein Bilderbuch so, daß der Erwachsene die Bilder richtig herum sehen kann. Auch sich selbst drehen sie so, daß man ihren Pferdeschwanz bewundern kann usw. - Kognitivisten würden daraus folgern, daß die Kinder eine ToM haben bzw. „sich in den anderen versetzen“ können, was eine Metapher ohne Erklärungswert ist. Empiristen würden nachsehen, wie die Kinder das Verhalten gelernt haben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2019 um 05.59 Uhr |
|
Terms such as intersubjectivity, theory of minds, and mentalization are often used interchangeably to convey the same basic idea. (Frederick Leonhardt) Wenn man das Verstellungsverhalten eines kleinen Kindes, das nur über wenig Worte verfügt, auf eine theoretische Begründung zurückführen wollte – was willkürlich genug wäre –, würde man ihm vielleicht eine psychologische Theorie des Geistes unterschieben. Es wäre freilich eine nicht sprachlich formulierte Theorie. Das ist schwer vorstellbar, da man unter einer Theorie ein System von Aussagen versteht. Kognitivisten setzen folglich oft eine mentale Sprache an, die irgendwie mit Konzepten und Propositionen dasselbe leistet wie die uns bekannten Sprachen mit Wörtern und Sätzen. Aus empiristischer Sicht eine zirkelhafte Scheinerklärung (Homunkulus, infiniter Regreß). Das Geistige ist eine Redeweise, eine Verständigungstechnik. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ und jedes Versteckspiel, „Guck-guck-da!“ usw. setzen alle eine „Theorie des Geistes“ voraus, wenn man so will, oder auch Perspektivübernahme usw. Es gehört zur Bedeutung, also zur richtigen Verwendung von sehen, wissen, denken usw., daß du nicht alles siehst, was ich sehe. Du siehst nicht alles, was ich sehe, hast also auch nicht alles gesehen, was ich gesehen habe, weißt also nicht alles, was ich weiß (wissen etymologisch = gesehen haben). Subjektivität ist etwas Gemeinschaftliches. Es gibt kein Problem der Erschließung des „Fremdseelischen“, weil das Fremde zugleich mit dem Eigenen, das Öffentliche zugleich mit dem Privaten eingeführt wird; die Begriffspaare bilden untrennbare Einheiten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2019 um 18.46 Uhr |
|
Hier ist noch einmal eine besonders einfache von tausend Darstellungen des False-belief-Tests: If you show a three-year-old a tube of Pringles and ask her to guess what is inside it, she will probably say, ‘Pringles’ (if she is suitably indoctrinated in the leading brands of snack food). If you then show her that there are in fact only pencils inside the tube, she will be surprised but will make the mental adjustment. Then, if someone named Steve enters the room and you ask your three-year-old, ‘What does Steve think is inside the tube,’ she will say, with all confidence, ‘Pencils.’ She doesn’t appreciate that Steve has a different experience of life than she. She doesn’t understand that Steve has a mind of his own. Do the same experiment when she’s four, and she’ll probably get it right, her theory of mind will be in place then. (Jonnie Hughes: On the origin of tepees. New York 2011:249) Das Fatale ist, daß die Psychologen und Philosophen, die dies übernehmen, dieselbe naive Theory of mind vertreten wie ihre Probanden. Sie fragen also bloß, wie Kinder dazu kommen, den ganzen Apparat der folkpsychologischen Redeweise zu entwickeln bzw. zu übernehmen, erkennen aber nicht, daß es sich nur um einen Sprachgebrauch (mit fiktionalen Konstrukten) handelt, in den man die Kinder einübt. Das dreijährige Kind versteht vermutlich die psychologischen Verben noch nicht. Man sollte untersuchen, ob es sonst schon in der Lage ist, einen anderen zu täuschen, etwa in entsprechenden Spielen, die auch eine „Theorie des Geistes“ vorauszusetzen scheinen, ohne aber von solchen schwierigen (auch historisch späten und nicht universell verbreiteten) Wörtern Gebrauch zu machen. Jedes Verstellungsspiel ist geeignet, und solche treten viel früher auf. Das hat man längst untersucht, und es ist von den Kritikern des False-belief-Tests auch schon oft dargestellt worden. Die Psychologie, die dem Kind zugleich mit der modernen Bildungssprache eingeredet wird, sieht vor, daß jeder Mensch sein radikal privates Innenleben hat, das nur ihm selbst direkt zugänglich ist und bei anderen erst erschlossen werden muß, durch eine Art Gedankenlesen (mind reading) usw. Die Forscher selbst glauben all das ebenfalls. Man könnte von einer naiven Psychologie der naiven Psychologie sprechen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2019 um 05.51 Uhr |
|
Zum Briefkastenphänomen (Löschen einer Aufgabe, nachdem sie gelöst ist): Ich weiß morgens, wo ich abends meine Brille hingelegt habe. Das ist erstaunlich genug und wird im einzelnen noch lange unerklärt bleiben. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie vorgestern abend hingelegt habe. Das ist mindestens ebenso erstaunlich. All dies wird gelernt, zusammen mit der Zeitordnung heute – gestern – vorgestern – morgen usw. Kinder können das zunächst nicht. Sie scheinen, wie auch die Ethnolinguisten bestätigen, den Nachtschlaf als Grundlage der Unterscheidung von heute und nicht-heute zu nutzen. In manchen Sprachen gibt es für gestern und morgen nur ein Wort, ebenso für vorgestern und übermorgen. Kritiker des False-belief-Tests haben festgestellt, daß Kinder und manche Tiere die „Strategie“ befolgen, einen Gegenstand dort zu suchen, wo sie das letztemal fündig geworden sind, auch wenn sie inzwischen gesehen haben, daß er anderswo versteckt worden ist. Diese Strategie ist ja auch im Normalfall sehr nützlich. Selbst die Trivialität, daß ein Gegenstand nicht zugleich am Ort A und am Ort B sein kann (Dingpermanenz), muß gelernt werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2018 um 06.30 Uhr |
|
Die Sprachgebundenheit des False-belief-Tests geht auch aus Untersuchungen hervor, die gezeigt haben, wie sehr die Leistung der Kinder vom mütterlichen bzw. familiären Kommunikationsstil abhängt. In gebildeten Kreisen werden eben die "autoklitischen Rahmen", also die schulmäßigen konditionalen Strukturen, ausdrücklich gepflegt und tagtäglich gefestigt. Zu nichtsprachlichen Verstellungsspielen sind auch andere Kinder imstande, nur mit der sprachlichen Formulierung wie bei den Tests haben sie Verständnisschwierigkeiten.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.04.2018 um 05.55 Uhr |
|
Ich knüpfe an den Haupteintrag an und betrachte die sprachlichen Voraussetzungen des False-belief-Tests genauer. Bei aller Verschiedenheit des Versuchsaufbaus und der sprachlichen Instruktionen geht es doch im Kern immer um den Ausdruck der Konditionalität. Aus naturalistischer Sicht wird das Kind durch akustische Reize gesteuert, nicht durch den "Inhalt" der Rede (ein hier sinnloser mentalistischer Begriff). Wie das funktioniert, hat Skinner angedeutet: "Kehren wir noch einmal zu einem Beispiel einfacher Konditionierung zurück, wobei eine naive Versuchsperson im Laboratorium der Koppelung von Glocke und elektrischem Schlag ausgesetzt wird. Sie mag einige Zeit brauchen, um „die Verbindung zu erlernen“, wie man sagt. Schneller geht es, wenn wir ihr sagen Wenn Sie die Glocke hören, bekommen Sie einen Schlag. Darin ist der wichtige autoklitische Rahmen Wenn ..., dann ... enthalten. Das Autoklitikum veranlaßt den Hörer gewissermaßen, auf eine bestimmte Weise zu reagieren. Besonders deutlich ist das bei einem konditionalen Mand. Wenn ich Ihren Namen rufe, antworten Sie mit „anwesend“ – das ist als Mand mit Sagen Sie „anwesend“ vergleichbar, außer daß der Hörer seine Reaktion so lange zurückhält, bis die Bedingung des Wenn-Satzes erfüllt ist. Das kann erst eintreten, wenn solche Sätze im Verhalten des Hörers als Ergebnis eines langen und schwierigen Prozesses wirksam geworden sind. Dieser Prozeß liegt nicht im Dunkeln. Wir verstehen, wie ein Kind als Mitglied einer Gruppe dazu kommt, auf ein Mand nur in Verbindung mit seinem Namen zu reagieren. Zuerst neigt es dazu, ímmer aufzustehen, wenn es den sprachlichen Reiz Steh auf hört, aber schließlich steht es nur noch auf, wenn es hört Hansi, steh auf. Das ist kaum etwas anderes als eine Reaktion auf das konditionale Mand Wenn dein Name Hansi ist, steh auf. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einem konditionalen Mand des Typs Wenn du die Antwort weißt, steh auf. Das Kind reagiert nur dann angemessen, wenn die Reaktion des Aufstehens infolge der konditionalen Aufforderung Wenn du die Antwort weißt ... von der diskriminativen Funktion, über die Antwort zu verfügen, gesteuert wird. Ebenso funktioniert eine Reaktion, die man als konditionales Takt bezeichnen könnte. Der sprachliche Reiz Wenn das Licht an ist, ist die Tür offen beeinflußt den Hörer insofern, als ein Verhalten, das zu einer offenen Tür paßt, unter die Steuerung durch ein Licht als diskriminativen Reiz gebracht wird. Man könnte den autoklitischen Rahmen noch deutlicher machen: „Licht an“ bedeutet „Tür offen“, und dies ließe sich erweitern zu Reagiere auf das Brennen des Lichtes wie auf den sprachlichen Reiz „Die Tür ist offen“. (...) Wenn wir sagen Wenn ich sage „Die Suppe steht auf dem Tisch“, dann ist das Essen fertig, dann verleihen wir dem sprachlichen Reiz Die Suppe steht auf dem Tisch dieselbe diskriminative Funktion, die Das Essen ist fertig hat. Dieselbe Steuerungsmacht kann ein nichtsprachlicher Reiz bekommen, wenn man sagt Wenn der Kessel pfeift, ist der Tee fertig." (Verbal Behavior, meine Übersetzung) Alle diese gelernten Äquivalenzen von Reizen beruhen letzten Endes auf der Fähigkeit zur Verstellung, einem So-tun-als-ob, pretending, wie im Haupteintrag angedeutet. Die großen Widersprüche, die in der Theorie der False-belief-Psychologie diskutiert werden, lassen sich lösen, wenn man nicht selbst der naiven Psychologie anhängt, die man untersuchen will. Unter "Verständlichkeit" und "Syntaktische Ruhelage" bin ich schon auf die besondere Schwierigkeit von Konditionalsätzen eingegangen, die spät erworben und in volkstümlicher Rede vermieden und ersetzt werden. Der schulmäßige irreale Konditionalsatz ist am unbeliebtesten. Die üblichen False-belief-Tests übersehen das meistens. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.04.2018 um 09.17 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1647#38279 Aus der Erleichterung, wenn die Mutter wieder auftaucht, kann man schließen, daß das sehr kleine Kind es für möglich hält, daß jemand oder etwas tatsächlich verschwindet, sich sozusagen in Nichts auflöst. Die von Piaget untersuchte Objektkonstanz wird gelernt. Das geschieht schon beim Hin- und Herschieben von Gegenständen; es prägt sich unaufhörlich ein, daß ein Gegenstand, der eben links lag, nicht mehr dort gesucht werden darf, wenn man ihn nach rechts geschoben hat. Wahrnehmen könnten wir auch eine Traumwelt, in der Dinge keine Konstanz haben. In Fantasy-Filmen sehen wir, daß Dinge sich verdoppeln und vervierfachen usw. Daran erkennen wir aber mit Kant gerade, daß es sich nicht um Wirklichkeit handelt. Warum soll die Schokolade, die vor den Augen des Kindes aus einer Schachtel in eine andere gelegt worden ist, nicht außerdem auch noch in der ersten sein? Logisch ist es möglich, nur physikalisch nicht. Die "Einbildungskraft" wird domestiziert, diszipliniert, aber das dauert und bleibt immer ein prekäres Kunststück. Was beim Kind als "false belief" diagnostiziert wird, geschieht auch uns, wenn wir zum Beispiel einen Gegenstand dort suchen, wo wir ihn immer hinlegen, und nicht dort, wo wir ihn letztesmal hingelegt haben. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 23.03.2018 um 11.44 Uhr |
|
Zu den emotionalen Zwischentönen (#38287): Hierzu passen vielleicht auch die "üblen Konnotationen, die mit dem Wort Atheist verbunden sind" (http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1512#38292), sie kommen m. E. erst dann richtig zum Vorschein, wenn man sich die deutsche Übersetzung (Gottloser) in Erinnerung ruft. Ich habe auch schon bemerkt, daß ich beim Englischsprechen viel redseliger, also offener werde. Den Unterschied, in einer Fremdsprache oder der Muttersprache zu sprechen, empfinde ich manchmal etwas ähnlich wie bekleidet oder unbekleidet herumzulaufen, daher vielleicht die größere emotionale Zurückhaltung im Deutschen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2018 um 17.11 Uhr |
|
Und noch weit in den Volksliederbereich hinein. (Und Koloraturarien? Und indischer Kunstgesang? Und lateinische Liturgie)
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.03.2018 um 17.01 Uhr |
|
Andererseits scheint mir in Kinderliedern dem Fakt, daß das Baby sowieso kein Wort versteht, durchaus teilweise Rechnung getragen zu werden, z. B. "La le lu, nur der Mann im Mond schaut zu, ...".
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2018 um 16.51 Uhr |
|
Beides trifft zweifellos zu. Zum ersten Punkt meine ich noch, daß es uns auch in einer Fremdsprache viel schwerer fällt, die emotionalen Zwischentöne aufzumodulieren, als in der vertrauten Artikulation der Muttersprache. (Das wird ja auch gegen Konferenzen und Fachdiskussionen in der Fremdsprache Englisch eingewandt: nicht nur daß Wörter fehlen, auch die Zwischentöne gehen verloren, so daß die Muttersprachler einen unverdienten Vorteil genießen.) Auch ich meine, daß Kinder etwas davon haben, wenn sie im ersten Jahr (vielleicht schon vor der Geburt) an den Klang und Rhythmus der Muttersprache gewöhnt werden, die sie ja nachweislich auch wiedererkennen, wie die Nuckelexperimente ergeben haben. Nur ob es notwendige Vorbedingung ist, wissen wir nicht. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 22.03.2018 um 16.41 Uhr |
|
Die meisten Menschen sprechen auch mit ihrem Hund so, als ob er es verstünde. Der hört auch nur den Klang. Der Grund ist wohl, daß es viel einfacher und weniger peinlich ist, in sinnvollen Wörtern und Sätzen zu loben oder zu schimpfen, anstatt in lobendem oder schimpfendem Tonfall nur beispielsweise immer "wau-wau-wau-..." zu sagen. Beim menschlichen Säugling kommt natürlich hinzu, daß er sich vielleicht doch schon an den Klang bestimmter Lautkombinationen gewöhnt und so schon lange bevor er anfängt zu sprechen, auf die Muttersprache vorbereitet wird. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2018 um 08.30 Uhr |
|
Warum sprechen wir etwa ein Jahr lang ständig mit dem Säugling, obwohl wir wissen, daß er kein Wort versteht? Das Kind läßt sich das gern gefallen, es "hört nur, daß es lieblich klingt" (Morgenstern); es ist wie Streicheln. Versteht es die Wörter nicht, so doch den Tonfall. Aber ist es eigentlich notwendig für das eigentliche Sprechen? Das Experimentum crucis entfällt aus ethischen Gründen. Besonders auffällig ist die elektrisierende Wirkung von Gesang und Musik. Alle normalen Kinder reagieren darauf. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.03.2018 um 06.10 Uhr |
|
Mit dem 11 Monate alten Kind kann man längere Zeit ohne Ermüdung Verstecken spielen, es versteckt sich auch selbst unter einem Tuch und kommt dann wieder hervor. Zuerst ist es aber immer der Erwachsene, der dieses aufregende Spiel des Verschwindens einleitet. Die extreme Fröhlichkeit, die das Wiedererscheinen auslöst, ist zweifellos auf Erleichterung zurückzuführen. Reziprok: Das Kind hält sich einen farbigen Plastikdeckel vors Gesicht, durch den es die Mama durchaus noch sehen kann und natürlich auch selbst gesehen wird. Das gilt offenbar ebenfalls als Verstecken und hat dieselbe Wirkung, wenn es den Deckel wieder wegnimmt. Das Schema "Nicht ernst" läßt sich auf alles mögliche übertragen. Es übt die Bewältigung von existentiellen Problemen ein: Man bleibt Herr über die Situation und über die eigenen Emotionen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 05.03.2016 um 17.23 Uhr |
|
Obwohl ich Jerome Bruners Psychologie nicht in jeder Hinsicht richtig finde (Fehleinschätzung des Behaviorismus), hat er in seiner Arbeit zur kindlichen Entwicklung und zum Spracherwerb recht gute Beobachtungen gemacht, z. B. in "Child's Talk", Oxford 1983. Dort auch zur Sprachgebundenheit der Kniereiterspiele usw. sowie zur Anlagerung früher Sprachformen an Spiele, in denen die Reziprozität des partnerschaftlichen Verhaltens eingeübt wird.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.12.2015 um 06.24 Uhr |
|
Was das Verhalten höherer Tiere betrifft, könnte man ihnen leicht eine Art Syntax unterstellen. Die erwähnten Hunde, aber auch Affen und Katzen, zeigen oft ein Verhalten, das sich analysieren läßt in "Beißen" plus "Spielgesicht", woraus eben ein spielerisches Verhalten, ein So-tun-als-ob resultiert. Man könnte auch von Test und (autoklitischem) Kommentar sprechen. Diese Zweigliedrigkeit gibt es aber nur unter phylogenetischer Betrachtung, synchron ist es ein holistisches Zeichenverhalten. Die Bestandteile sind nicht frei kombinierbar. Also dasselbe wie bei jenen superklugen Hunden, die tausend "Namen" von Gegenständen zu beherrschen scheinen. In Wirklichkeit sind sie alle mit dem Apportieren verbunden und nicht in anderen Zusammenhängen verwendbar. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.11.2015 um 08.27 Uhr |
|
Banal, aber doch aufschlußreich ist die bekannte Scherzfrage, der wohl die meisten von uns schon mal zumn Opfer gefallen sind, hier nach Wikipedia ("Scherzfrage"): Zum Beispiel lässt man eine Person zehnmal schnell hintereinander das Wort „Blut“ sagen, dann stellt man die Frage: „Bei was gehst du über die Straße?“. Die meisten Menschen antworten darauf: „Bei Rot!“. Ein weiteres Beispiel wäre, dass man eine Person zehnmal „weiß“ sagen lässt und anschließend fragt „Was trinkt die Kuh?“ Die meisten antworten dann mit „Milch“. - Dies zeigt, daß sprachliche Reaktionen von gewissen Reizen „getriggert“ werden können, die sich über die Logik hinwegsetzen. Die Frage ist ja eigentlich glasklar formuliert, trotzdem ist ein anderer Reiz in diesem Augenblick wirksamer. Wir staunen dann mit Recht über unsere eigene Dusseligkeit. |