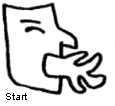


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
06.11.2014
Deixis und Subjektivität
Ein Schrittchen zur Naturalisierung des Geistes
Viele Sprachen unterscheiden zwischen einer Deixis der ersten und einer Deixis der zweiten Person, also lat. zwischen hic und iste, griechisch hode und houtos usw. (Die Ferndeixis und weitere Abstufungen lasse ich hier weg.)
Es fällt nun auf, daß dieselben pronominalen Stämme auch zur Textphorik, also zum Voraus- und Zurückverweisen gebraucht werden, und zwar so, daß mit der Deixis der zweiten Person auf schon Gesagtes, mit der der ersten Person auf noch zu Sagendes verwiesen wird. Wenn man Sonderfälle wie Korrelatives ausschaltet, gilt das mit großer Regelmäßigkeit. Die Erklärung liegt nahe: Was ich schon gesagt habe, ist gewissermaßen "bei dir da"; was ich noch sagen will/werde, ist noch "bei mir hier". So weit, so gut (ich habe es anderswo schon mal ausgeführt).
Schon die bloße Redetechnik setzt also praktisch voraus, daß ich etwas "mitteilen" oder eben auch "für mich behalten" kann. Beide Techniken verweisen auf etwas nicht (nicht mehr oder noch nicht) Wahrnehmbares – aber wo ist es? Im "Geist" natürlich. Auch ohne ausdrücklich darüber nachzudenken, setzt jeder der beiden Gesprächspartner eine "Innerlichkeit" voraus, einen (metaphorischen) Raum radikaler Privatheit. Daß du nicht weißt, was ich denke – und umgekehrt –, gehört zu den Voraussetzungen des Sprechens.
| Kommentare zu »Deixis und Subjektivität« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2025 um 03.56 Uhr |
|
Ein beliebtes Verfahren anspruchsloser Medien ist seit einigen Jahren: „Ein Mann kommt nach Hause und sieht DAS: ...“ Auch in der Werbung: „Tinnitus? Hören Sie auf, das zu tun.“ (Es entspricht ungefähr der modischen Doppelpunktsetzung: "Das Ganze ist einfach: dumm.") Es ist ein klarer Fall von Kataphora, also "Hinabverweisen" im Text, das Gegenteil von Anaphora, dem "Hinaufverweisen". Die Modellierung der Rede nach oben und unten ist aufzulösen als früher oder später bzw. nach "bei dir" und "bei mir". Was ich schon gesagt habe, ist damit bei dir; was ich noch sagen werde oder sagen könnte, ist "bei mir". Darum werden in Sprachen, die hier einen Unterschied machen, also etwa im Altgriechischen, die Demonstrativa der ersten bzw. zweiten Person verwendet: houtos vs. hode. Das funktioniert aber nur, wenn die Satzgrenze überschritten wird, wenn also die gequantelte Rede einen "Schritt" gemacht hat. Sätze sind solche Schritte, darum gibt es sie. Der Empfänger muß wissen, wann etwas behauptet, aufgetragen oder gefragt worden ist, so daß er darauf reagieren kann. "Wer das liest, ist doof" oder etwas anspruchsvoller "Giorgione wurde wegen seiner Größe so genannt" (Quines Beispiel) sind im Grunde fehlkonstruiert, weil der Bezug von "das" bzw. "so" nicht eindeutig ist; sie verweisen normalerweise aus dem Satz heraus, in dem sie stehen. Erst durch unsere Gewöhnung an "sloppy reference" konstruieren wir daraus ein Paradoxon. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.05.2025 um 15.35 Uhr |
|
Es soll Sprachen geben, die kein "rechts" und "links" kennen, sondern gegebenenfalls "talauf" und talab" sagen. Penelope Brown glaubte das im Tseltal feststellen zu können, aber ich erinnere mich, es schon früher über Sprachen im Hindukusch (?) gelesen zu haben. Die Versuche, die solchen Thesen zugrunde liegen, sind durchweg ziemlich künstlich. Vielleicht sind es Artefakte der Methode – wie z. B. die ständig weitergegebene Legende, daß manche Völker sich überhaupt nicht darum bemühen, ihren Kindern die Sprache beizubringen, so daß diese sie ausschließlich aus mitgehörten Erwachsenengesprächen lernen müssen. Ich glaube inzwischen gar nichts mehr. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.03.2024 um 19.40 Uhr |
|
Eine neue, strikt verhaltensanalytische Darstellung von Zeigen und Deixis ist dringend nötig. Sie müßte also von metaphysischen Begriffen wie „Intentionalität“ frei sein. Auf dem Weg dorthin möchte ich einen Abschnitt einfügen, der einiges aus früheren Einträgen wiederholt, aber auch ein paar neue Gedanken enthält: Das gegenstandsbezogene Zeigen ist nur dem Menschen eigen. Darüber herrscht allerdings keine Einigkeit. Nach David Leavens, Sue Savage-Rumbaugh u. a. zeigen Affen – wenigstens in Gefangenschaft – ständig, nach Julia Fischer, Michael Tomasello u. a. überhaupt nicht. Zum Teil handelt es sich um eine Definitionsfrage. So sollte weder die bloße Richtungsanzeige noch jede Situationsabhängigkeit als Deixis bezeichnet werden (vgl. Peter Auer: „On deixis and displacement“. Folia linguistica 22/1988:263-292). Weitere Klärung im folgenden. Das Zeigen wird von einigen Autoren auf das Greifen zurückgeführt. „(Die hinweisende Geste) ist genetisch betrachtet nichts anderes als die bis zur Andeutung abgeschwächte Greifbewegung.“ (Wilhelm Wundt: Völkerpsychologie. Bd.1: Die Sprache. 2. Aufl. Leipzig 1904:129f.) – „Zeigen ist eine Abschwächung des Ergreifens...“ (Walter Porzig: Das Wunder der Sprache: 6. Aufl. München 1975:24). Vgl. Cassirer, Leavens u.a. Andere erwägen eine Herleitung aus dem Werfen (William Calvin; auch Skinner denkt an diese Möglichkeit). Der Zoologe Berhard Rensch schrieb mir vor langer Zeit, er habe sich oft über das treffsichere Werfen bei Menschenaffen gewundert. Für das Greifen spricht, daß es beim Kind viel früher auftritt als das Werfen (gemeint ist gezieltes Werfen, nicht Wegwerfen). Das Kind streckt die Hand nach etwas aus, kann es aber wegen der Entfernung nicht erreichen; der Erwachsene gibt ihm das Gewünschte. Roland Posner meint: „Das Greifen nach einem Gegenstand wird, wenn klar ist, dass der Gegenstand unerreichbar ist, als Zeigen verstanden.“ („Alltagsgesten als Ergebnis von Ritualisierung“. In: Forschungsberichte des Instituts für Phonetik und Sprachliche Kommunikation der Universität München 37/2001:5-24, S. 6) Das ist nicht richtig. Der Erwachsene deutet den ausgestreckten Arm des Kindes nicht als Zeigen, sondern immer noch als Habenwollen, und hilft ihm, das Gewünschte zu erlangen. Kinder lernen zwar sehr bald, daß es genügt, die Hand nach etwas auszustrecken, um es mit Hilfe der Erwachsenen zu bekommen; ohne deren Anwesenheit versuchen sie es nicht auf diese längst als vergeblich erkannte Weise. Die Geste ist daher kommunikativ (zeichenhaft), aber auf eine einzige Funktion beschränkt und daher noch kein Zeigen im eigentlichen Sinn. Der Fall ist vergleichbar mit jenen Tieren, die auf ein Signal hin einen Gegenstand apportieren oder eine andere Manipulation damit ausführen und denen man fälschlich unterstellt, sie hätten den Namen des Gegenstandes gelernt (s. zu den Sprachversuchen mit Tieren). Das eigentliche Zeigen führt einen Gegenstand als Redegegenstand ein, läßt aber offen, was es damit auf sich hat – sozusagen das Rhema zum Thema. Gerade diese Offenheit macht gegenüber der monofunktionalen Festlegung des Greifens das Zeigen aus. Das „Referieren“ mit Hilfe der Zeiggeste ist also kein eigenständiger Sprechakt, sondern nur die erste Hälfte eines solchen. (Vgl. Clemens-Peter Herbermann: Modi referentiae. Studien zum sprachlichen Bezug zur Wirklichkeit. Heidelberg 1988:26, wo etwas ähnliches festgestellt wird, wenn auch in anderen Begriffen.) Das ist auch der Grund, warum wir erstaunen und erschrecken würden, wenn wir diese offene Geste bei einem Menschenaffen beobachteten: Wir müßten ihm eine wirkliche Sprache nach Art der unseren zuschreiben. Während der lautliche Teil der Sprache beliebig stilisiert und daher vollkommen willkürlich (arbiträr, konventionell) werden kann, muß das Zeigen seine konkrete räumliche Ausrichtung beibehalten. Es gibt wenigstens drei vergleichbare Gesten: Die Gesten des Herbeirufens (mit Finger, Hand, Unterarm) und des Aufhaltens oder Stoppens (mit der Handfläche) sind zweifellos aus dem Heranziehen bzw. Zurückstoßen abgeleitet (Skinner: Verbal behavior S. 466) und niemals so weit stilisierbar, daß der räumliche Zusammenhang gänzlich verlorengeht. Das gilt drittens auch für die Geste des Darbietens oder Anbietens, die ebenfalls menschenspezifisch zu sein scheint: „Most strikingly, nonhuman primates do not point or gesture to outside objects or events for others, they do not hold up objects to show them to others, and they do not even hold out objects to offer them to others.“ (Michael Tomasello: Constructing a language. Cambridge, Mass. u. London 2003:10f.) Diese Gesten gehören insofern zur selben Klasse wie das Zeigen. Géza Révész (Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Bern 1946:60) lehnt die Herleitung aus dem Greifen ab, weil Zeigen kommunikativ sei, Greifen aber nicht. Das ist nicht schlüssig, weil es ja gerade darum geht, welches Verhalten durch empfangsseitige Semantisierung kommunikativ geworden sein könnte; dabei kann die ursprüngliche Funktion verlorengegangen sein. Nach meiner Beobachtung geht das Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres von der ausgestreckten Greifhand zum Zeigefingerzeigen über und löst die Geste vom Habenwollen ab. Daß alle Menschen, aber keine anderen Tiere zeigen können, ist kein Beweis für die spezifische Angeborenheit der Zeigfähigkeit. Sie könnte sich auf der Grundlage einer anderen, wirklich elementaren Fähigkeit in jeder einzelnen Konditionierungsgeschichte herausbilden. Die gleiche Frage stellt sich bei unzähligen spezifisch menschlichen Tätigkeiten, die wie Natur aussehen, aber Kultur sind, vor allem natürlich bei der Sprache. Der Übergang vom monofunktionalen Greifen (Habenwollen) zum multifunktionalen Zeigen wird plausibler, wenn man an Metaphern für Thematisierung denkt wie Nehmen wir Afghanistan... Der Gegenstand wird gleichsam ins Gespräch gezogen. Wir sprechen auch vom Aufgreifen, Wiederaufgreifen und Herausgreifen eines Themas. Wenn man das Zeigen vom Werfen herleitet, wird wohl das Zielen der gemeinsame Grund sein, mit dem das „Intentionale“ auch etymologisch verbunden ist. Die Einzelheiten sind hier aber weniger leicht zu rekonstruieren. Die Spitzigkeit des Zeigefingers dient der Vereindeutigung, ist aber auch der Grund der Tabuisierung des Zeigens auf Personen. So ist es bei uns sprichwörtlich verpönt, „mit nacktem Finger auf angezogene Menschen“ zu zeigen. Bei verschiedenen Völkern findet man unterschiedliche Bevorzugung des Zeigens mit Zeigefinger, Hand, Kopf, Augen oder Lippen. Cornelia Müller: „Zur Unhöflichkeit von Zeigegesten“. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 52/1996:196-222. Müller berücksichtigt ältere Benimm-Bücher, eine Textsorte, die das Zeigen immer stark beachtet hat. Allerdings fehlt es dadurch an Empirie, was die wirkliche Praxis betrifft. – „Der Vulgäre zeigt mit dem Daumen, der ‚Durchschnittliche‘ mit dem Finger, der Gebildete mit der Hand.“ (Ilse Leisi/Ernst Leisi: Sprach-Knigge. 2. Aufl. Tübingen 1993:21) Mit dem Daumen kann man eigentlich nur über die Schulter, jedenfalls vom Bereich des Adressaten weg verweisen. Es ist auch das traditionelle Richtungszeichen des Anhalters. Mit dem gewöhnlichen Zeigen steht es eigentlich kaum in einer Konkurrenz nach dem Maß der Höflichkeit. Setzt die Zweiheit von Zeigen + Kommentar das „propositionale“ Verfahren der Verständigung voraus oder ist es deren Ursprung? Das wäre noch zu untersuchen. Nach einigen Psychologen lernt das Kind schon vor dem Zeigen die Dingkonstanz und die beiden schematischen Unterscheidungen: ein Ding mit vielen Eigenschaften, viele Dinge mit der gleichen Eigenschaft. Die Verbindung von konkreter Zeiggeste und abstraktem (appellativischem) Kommentar könnte daran anschließen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 27.03.2024 um 05.53 Uhr |
|
Zu Eigennamen: Dawkins über Papst Johannes Paul II.: „He believed he was saved by ‘Our Lady of Fatima’ who ‘guided the bullet’ so it didn’t kill him. Not just ‘Our Lady’ but specifically ‘Our Lady of Fatima’.“ (Outgrowing God 43) Das entspricht antiken Vorstellungen. Zeus war auch immer derselbe Gott, aber zugleich an verschiedenen Orten immer ein spezieller. Als die Babylonier schon wußten, daß „Morgenstern“ und „Abendstern“ denselben Planteten bezeichneten, fuhren sie fort, beide Gottheiten zu verehren. Vgl. den indischen „Henotheismus“. In der Fabel ist „der Wolf“ irgendwie immer derselbe, manifestiert sich aber in vielen. Ähnlich die Monate: der April ist jedes Jahr ein anderer, aber zugleich derselbe, wiederkehrende, daher der bestimmte Artikel. (So auch das Volkslied: „... der Frühling kehrt wieder“.) Nicht auszudenken, was spätere Interpreten aus diesen unseren Sprachgewohnheiten herauslesen werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.03.2024 um 08.42 Uhr |
|
„The process of naming involves a process like sticking a label on an object.“ (L.R. Palmer: Descriptive and comparative linguistics. London 1972:2) Das stimmt natürlich nicht. Man erkennt die Weinflasche am Etikett, aber nicht Fritz Müller am Namen. Schon Bühler referiert und kritisiert diese Etikettentheorie der Namen bzw. der Sprache. |
Kommentar von Theodor Icker, verfaßt am 21.01.2023 um 16.31 Uhr |
|
Primatologen stellen fest, daß unsere nächsten Verwandten nicht nur nicht zeigen, sondern auch keine Gegenstände vorzeigen oder anbieten (zu unterscheiden vom bloßen Hergeben). Zeigen und vorzeigen sind nicht zufällig vom gleichen Stamm gebildet. Wir müssen ein Mosaiksteinchen nach dem anderen zusammentragen, um die wirklichen Elemente zu finden, aus denen komplexes Verhalten wie das Sprechen zusammengesetzt ist. Es ist dann zwar immer noch menschenspezifisch und angeboren, aber nur weil die Elemente es sind, die wir zum Sprechen exaptiert haben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.04.2022 um 17.14 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1627#40147: Affen, Hunde, Pferde verstehen Zeiggesten als Richtungshinweise, nicht gegenstandsbezogen. Im günstigen Fall suchen Affen oder Hunde in dem auffällig gemachten Bereich des Gesichtsfeldes und stoßen dabei auf den Gegenstand, den der zeigende Mensch gemeint hat. Fraglich ist, ob dieses Verständnis beim Menschen angeboren ist oder ob der Gegenstandsbezug für Kinder erst durch das sprachliche Herausheben (Highlighting) des Gegenstandes zustande kommt. Am Anfang können Kinder das noch nicht, aber es kann gelernt oder gereift sein, das ist schwer zu unterscheiden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.09.2019 um 03.24 Uhr |
|
„Anders als Kleinkinder verstehen Affen Zeigen nicht.“ (Ethologin Julia Fischer vom Göttinger Primatenzentrum)
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.12.2018 um 18.10 Uhr |
|
Pointing can convey an almost infinite variety of meanings by saying, in effect, "If you look over there, you’ll know what I mean". To recover the intended meaning of a pointing gesture, therefore, requires some fairly serious „mindreading“. (Michael Tomasello, Malinda Carpenter, Ulf Liszkowski: A new look at infant pointing) Das ist überflüssiger Mentalismus, ebenso die Frage, ob die Kinder nur ein Verhalten des Partners herbeiführen oder dessen mentalen Zustand beeinflussen wollen. Warum sollte man den Kindern die Theory of Mind unterstellen? Haben die Erwachsenen denn eine? Auch in Gesellschaften, die das folkpsychologische Konstrukt des „Geistes“ nicht kennen, funktioniert das Zeigen genau wie bei uns. Leider zieht Tomasello sogleich Grice heran mit seinen überflüssigen Intentionen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.12.2018 um 17.31 Uhr |
|
Ja, es ist erstaunlich, was wir alles mit Verbzusätzen machen, nichts ist so charakteristisch für das Deutsche: Putin schließt Frieden mit derzeitiger ukrainischer Regierung Wie schön, denkt man, aber es geht weiter: Putin schließt Frieden mit derzeitiger ukrainischer Regierung aus (welt.de) |
Kommentar von R. M., verfaßt am 02.12.2018 um 10.39 Uhr |
|
Durch vor-, her-, vor allem aber (dar)auf wird der Unterschied zwischen show und point at (montrer/indiquer) im Deutschen meist auch hervorgehoben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.12.2018 um 09.48 Uhr |
|
Das Greifen nach etwas Unerreichbarem ist so wenig ein Zeigen, wie der Apportierbefehl (s. Rico, unter "Sprechende Hunde") ein Benennen ist. Zeigen ist für sich allein nicht kommunikativ, sondern immer nur Teil eines Sprachverhaltens. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.12.2018 um 07.02 Uhr |
|
Von meiner ersten Tochter habe ich notiert, daß sie mit 1;8 eigentlich immer noch keine Wörter sprach (gelegentlich ein Hindi-Wort vom Kindermädchen?), sich aber auf vielfältige Weise verständlich machte und auch viel verstand. "Das Zeigen hat Züge eine angedeuteten Greifens, soweit es um Dinge geht, die sie haben will. Auf Fernes, das ihr auffällt, zeigt sie mit ausgestrecktem Arm, aber meistens ohne ausgestreckten Zeigefinger, eher mit Greifhand." (Januar 1976) Man kann nicht feststellen, ob das Fingerzeigen sich spontan herausbildet oder als Nachahmung der Erwachsenen. Das ist schade, aber wer will das Experimentum crucis unternehmen? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 01.12.2018 um 04.12 Uhr |
|
Englischsprecher wundern sich vielleicht, daß wir zwischen to point und to show nicht unterscheiden. Wenn ich zum Kind sage: Zeig mir deinen Wauwau!, dann kann es den Plüschhund greifen und mir entgegenstrecken ("vorzeigen") oder einfach mit dem Finger darauf zeigen. Demonstrativa fangen in nichtverwandten Sprachen oft mit einem Dental an: chines. tâ usw. – Zungenspitzenzeigen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.11.2018 um 07.35 Uhr |
|
Cooperrider et al. untersuchen im Kulturvergleich, ob das Hand- oder Fingerzeigen gegenüber anderen Formen universell bevorzugt wird. Interkulturelle Unterschiede im Gebrauch von Zeigverfahren (Zeigefinger, Hand, Kopf, Lippen, Augen) sind aber kein Einwand gegen die Universalität des Fingerzeigens, denn gerade der Gebrauch des Zeigefingers ist gesellschaftlichen Einschränkungen unterworfen. So ist es bei uns sprichwörtlich verpönt, „mit nacktem Finger auf angezogene Menschen“ zu zeigen. Solche Tabus sind in anderen Gesellschaften noch stärker. Cooperrider et al. erwägen auch die Tabu-Erklärung, weisen sie aber mit unzulänglichen Gründen zurück; sie haben nicht untersucht, ob in natürlicher Kommunikation bestimmte Klassen von Gegenständen (Personen) verschieden gezeigt werden. Immerhin: (In) Western Educated Industrialized Rich Democratic (WEIRD) societies (...), the prototypical form of pointing is with the hand and, specifically, with the index finger extended. (Das Kürzel WEIRD geht auf einen bekannten Aufsatz von Joseph Henrich zurück, der auch zitiert wird. Vgl. http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1506#22125) Ich vermute, daß das Zeigen mit dem Zeigefinger eine Stilisierung des Greifens ist, wobei die "Zuspitzung" signalisiert, daß nicht gegriffen, sondern gerade eben noch berührt wird, und selbst da kann noch eine Lücke eingefügt werden. Das Greifen wird dadurch zum Als-ob und eben damit kommunikativ, was das Greifen nicht war. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 22.11.2018 um 04.59 Uhr |
|
Während Leavens das Zeigen unter Menschenaffen für allgegenwärtig hält, sagt die deutsche Primatenforscherin Julia Fischer, daß sie das Zeigen überhaupt nicht verstehen. Das läßt auf ein eher begriffliches als sachliches Problem schließen, also ähnlich der Frage, ob Tiere denken. Die Zuschreibung von Zeigen wäre dann die Entscheidung für oder gegen eine mentalistische Begrifflichkeit. So hat man das Problem meines Wissens bisher noch nicht gesehen, sondern "Zeigen" immer für einen naturalistischen Begriff gehalten. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2018 um 16.03 Uhr |
|
David A. Leavens hat besonders eingehend Zeigverhalten bei Menschenaffen behandelt, allerdings hauptsächlich in Gefangenschaft. Einige Texte sind im Internet greifbar. Darauf wäre zurückzukommen.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2018 um 14.26 Uhr |
|
"Wenn man einem Dummen den Mond zeigt, blickt er auf den Finger und nicht auf den Mond." (Chines. Sprichwort) (Was sonst?) Es ist nicht ganz leicht, eigenes Zeigen und Befolgen der Zeiggeste bei Kindern eindeutig zu beobachten. Unsere Jüngste hat mit 1 Jahr gezeigt und das Zeigen verstanden. Bei der anderen habe ich mit 1;6 eindeutige Belege, und unter 1;10 steht: Auf die Aufforderung "Zeig mal dem Teddybär den Mond!" trägt sie ihn zur Terrassentür und zeigt ihm den Mond. Davon zu unterscheiden ist jeweils das Vorzeigen von Dingen, das um einiges früher auftritt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 21.11.2018 um 12.03 Uhr |
|
Auch zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1584#40128, "Zwar können nur Menschen zeigen, aber das bedeutet nicht, daß das Zeigen angeboren ist": Ich habe in letzter Zeit bei meinen Enkeln auch öfters verwundert festgestellt, daß sie das Zeigen erst lernen müssen. Ich kann noch so deutlich auf einen Ball zeigen und dazu sagen, "Kuck mal, da ist der Ball", die Ein- oder Zweijährigen begreifen einfach nicht, daß sie in die Richtung des ausgestreckten Arms und Fingers blicken sollen, sondern sie schauen immer auf den Finger, als ob da etwas geschieht. Wobei ich aber jetzt nicht genau sagen kann, ab welchem Alter sie in die gezeigte Richtung sehen. Ich glaube, es war irgendwann im 2. oder 3. Jahr. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2018 um 11.22 Uhr |
|
Manche Tiere folgen Richtungshinweisen. Oft geht es um das Auffälligmachen eines räumlichen Bereichs. Gegenstandszeigen ist etwas anderes.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 21.11.2018 um 10.21 Uhr |
|
Wenn der Hund einen Holzstoß anbellt und seinen Herrn zwischendurch ansieht, scheint er auf den Stapel zu zeigen. Vielleicht tut er es sogar? Dieser Eindruck und der Umstand, daß Hunde Fingerzeigen folgen können, läßt sie so beredt wirken.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2018 um 08.26 Uhr |
|
Wir würden uns wundern und auch erschrecken, wenn ein Affe eindeutig auf etwas zeigen würde. Das Zeigen ist die Hälfte eines Sprechaktes, es kommt nur in Aussagen usw. vor. Beim Greifen ist der Blick auf den Gegenstand gerichtet, beim Zeigen auch auf den Kommunikationspartner (wenn der nicht ohnehin in die richtige Richtung blickt, also wenn ich ihm nachts den Polarstern zeige usw.). Wenn das Zeigen wie das Referieren vom Wollen abgeleitet ist (beide Begriffe von Intentionalität also zusammenhängen), dann ist das zeigende Wesen zum Handlungsschema fähig (s. zur Naturalisierung der Intentionalität) und damit zur Sprache. Dieser Sprung würde uns das Zeigen des Gorillas so unheimlich machen. Wir würden denken: Der kann ja sprechen! |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 21.10.2016 um 18.21 Uhr |
|
Wenn der Familienname vor dem Rufnamen steht, setzt man ein "der" vor den Familiennamen, jedenfalls im süddeutschen Hochdeutsch: "der Huber Alois".
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.10.2016 um 17.04 Uhr |
|
Aus der Dudengrammatik: „Wenn bei unpersönlichen Verben das Pronomen es durch das ersetzt wird, wird dem beschriebenen Ereignis eine besondere Intensität zugeschrieben: Das blitzt und donnert ja unheimlich! Wie das wieder durch die Ritzen zieht!“ (285) Wenn das zutrifft – wie erklärt es sich? Es liegt ja auf den ersten Blick nicht gerade nahe, daß ein Pronomen diese Wirkung haben könnne. Meiner Ansicht nach weist das Demonstrativum aus dem Bereich des Sprechers hinaus in den des Hörers. Der "gezeigte" Gegenstand wird gewissermaßen dem Hörer zugeschoben (natürlich autoklitisch, also nicht ausdrücklich). Man könnte umschreiben: "Das ist nicht meins, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, sag du es..." Ähnlich wirkt so: Das war so schön! (= Das war so schön, wie du dir nur denken kannst.) Deutlicher wäre so etwas wie der/das da, entsprechend lat. iste und griech. houtos. Der Exklamativsatz verstärkt die Wirkung, denn der läuft ja immer auf eine Stellungnahme des Hörers hinaus. Gallmann geht anschließend auf die Unhöflichkeit des Pronomens der beim Bezug auf Personen ein. (Die Beispielgruppe c gehört nicht hierher, weil gerade dieser Bezug gar nicht vorhanden ist.) Hier fehlt jedoch ein Hinweis, auf die Unverfänglichkeit und Unvermeidlichkeit des Demonstrativums bei Linksversetzung und verkappten Relativsätzen: Mein Freund, der sagt das auch immer. (*er) Ich habe einen Freund, der sagt das auch immer. (*er) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 14.04.2016 um 17.11 Uhr |
|
Manche haben das Zeigen aus dem Werfen abgeleitet (William Calvin, evtl. Skinner), andere aus dem Greifen (Wundt, Cassirer). Géza Révész (Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Bern 1946:60) lehnt letzteres ab, weil Zeigen kommunikativ sei, Greifen aber nicht. Das ist nicht schlüssig, weil es ja gerade darum geht, welches Verhalten durch empfangsseitige Semantisierung kommunikativ geworden sein könnte. Neuerdings wird weiteres zur Stützung der Greifen-Hypothese beigetragen: Lenkung der Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, auch wenn er gar nicht in Reichweite ist. (Tomasello) Der Zoologe Berhard Rensch schrieb mir vor Jahrzehnten, er habe sich oft über das treffsichere Werfen bei Menschenaffen gewundert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2016 um 09.45 Uhr |
|
Ach, das ist bloß zur Verdeutlichung, weil "Ausrichtung" alles mögliche bedeuten kann und weil "konkret" eben das Gegenteil der rein begrifflichen Beziehungen ist. Die Teile eines Bestandssystems sind eben wirklich oder "konkret" beieinander wie die Teile eines Fahrrads oder die Mitglieder einer Gruppe und werden nicht nur wie Gattung und Art "in Gedanken" zusammengebracht. Die Götter, denen manche Menschen an Altären opfern usw., sind auch mit diesen Menschen zusammen. Fiktionalität spielt in dieser Hinsicht noch keine Rolle. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 04.04.2016 um 09.04 Uhr |
|
Was ist dann der Unterschied zwischen Ausrichtung und »konkreter Ausrichtung«?
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2016 um 04.59 Uhr |
|
Die Schwurhand "zeigt" so wenig wie der Stinkefinger.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.04.2016 um 04.55 Uhr |
|
Den Schweif nehme ich zurück, die konkrete Ausrichtung nicht. Daß ein Gegenstand nur eingebildet ist, ändert doch nichts. Es geht um die Nichtwillkürlichkeit, Nichtkonventionalisierbarkeit (das Nichtarbiträre) der Geste oder Gebärde. Ich unterscheide übrigens nicht zwischen konkreten Gegenständen und anderen, weil Konkretheit/Abstraktheit für mich keine Sorten von Gegenständen, sondern Bezeichnungstechniken sind. Deshalb brauche ich mir auch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, ob der Osten konkret ist. Sprachlich ist er es. Anderswo hatte ich gesagt, daß der Geist ein Körperteil ist, denn sprachlich wird er so behandelt (Bahuvrihi, Pertinenzdativ). |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 03.04.2016 um 21.36 Uhr |
|
Und beim Meineid-Schwören zeigen hinter dem Rücken zwei Finger nach unten.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 03.04.2016 um 20.06 Uhr |
|
Die Richtung muß stimmen, aber es geht auch ohne konkrete Gegenstände, anders als es die Formulierung »eine bestimmte konkrete Ausrichtung auf den Gegenstand« suggeriert. Eine Himmelsrichtung ist ja z. B. auch keiner. (Und Hunde haben keine Schweife, das hatten wir doch letztens erst.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2016 um 16.31 Uhr |
|
Die Richtung muß aber stimmen, sonst könnten Sie auch auf die Kellertreppe zeigen. (Dort sitzt vielleicht der Teufel.) Folglich hat die Ritualisierung genau die Schranke, die ich gemeint habe.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 03.04.2016 um 10.25 Uhr |
|
Den Zeigefinger gen Himmel zu richten und damit auf Gott (bzw. seine Hilfe) zu deuten ist aber eine ziemlich ritualisierte Geste; schließlich kann der Atheist da oben nichts sehen (wie einst schon Gagarin feststellte).
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.04.2016 um 09.44 Uhr |
|
Im Gegensatz zu anderen Verhaltensweisen kann das Zeigverhalten nicht beliebig ritualisiert werden, sondern es muß eine bestimmte konkrete Ausrichtung auf den Gegenstand vorhanden sein und bleiben, sonst könnte die räumliche Orientierung nicht funktionieren. Es kann also nicht so vollkommen arbiträr werden wie etwa das Schweifwedeln des Hundes oder Saussures arbre/Baum. Das hat zur Folge, daß das Zeigen wegen seiner Konkretheit die Existenz des Gezeigten präsupponiert: "Der Zeigefinger ist der Wegweiser vom Nichts zum Sein." (Ludwig Feuerbach) Ob die Zeiggeste nun aus dem Werfen oder aus dem Greifen entstanden ist – wie diese beiden Verhaltensweisen erzeugt es eine reale Verbindung. Auf jemanden zeigen ist wie jemanden an der Hand halten die Schaffung eines "Bestandssystems" (im Unterschied zu einem "Begriffssystem"). |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.11.2014 um 08.58 Uhr |
|
Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, daß sich der Sprecher auf das Innere des Hörers bezieht (vom Schreiben und Lesen müssen wir absehen, das ist nicht der Ort, an dem die deiktischen und phorischen Redemittel entstanden sind). Vielmehr vermute ich, daß die Privatheit, also das metaphorisch (bzw. "transgressiv") verstandene "Innere", ihren Ursprung in dieser Verständigungssituation hat. Zur Unterstützung nur eine Beobachtung: Wenn jemand fragt: "Meinst du die Anna?" und ich antworte: "Ja, genau die!", dann kann man sich vorstellen und auch beobachten, daß ich mit dem Zeigefinger auf den Partner zeige, als identifizierte ich die Anna "beim" Hörer. Die räumliche Verteilung des "Wissens" liegt auch einigen Modalpartikeln zugrunde, wie ich in meinem Aufsatz über diese dargelegt habe. Ich werde das mal genauer ausarbeiten, lieber Herr Achenbach, es beschäftigt mich seit meiner Studienzeit. |
Kommentar von V.P., verfaßt am 12.11.2014 um 15.58 Uhr |
|
Bei Texten scheint es doch so zu sein, daß zurückverweisende Ausdrücke sich nicht auf einen Ort im "Inneren" des Lesers beziehen, sondern auf etwas, das im vorangehenden Text steht und vom Leser bereits zur Kenntnis genommen wurde. Von den Gedanken, die jemand ausgesprochen oder z.B. in einem Brief formuliert hat, sagt man für gewöhnlich nicht, daß sie sich "im Geist" / "im Kopf" des Lesers oder Verfassers befinden. Die metaphorische Rede vom "Inneren" scheint für den Fall vorgesehen, daß jemand eine Rede vorformuliert oder eine Rechenaufgabe löst, ohne wahrnehmbare Zeichen zu produzieren. Wenn wir in der Verlegenheit sind, einen Ort für diese geräuschlosen Aktivitäten angeben zu müssen, sagen wir, er habe die Aufgabe im Kopf gelöst oder die Rede im Geiste geprobt. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 07.11.2014 um 18.26 Uhr |
|
Mir würden ein paar Beispiele wahrscheinlich sehr helfen.
|
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 07.11.2014 um 14.43 Uhr |
|
Ich verstehe kein Wort.
|