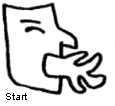


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Theodor Icklers Sprachtagebuch
06.05.2013
Stimmen
Sprache ist mehr als Laute
Vielleicht hat die Schrift dazu beigetragen, daß wir das Sprechen als die Erzeugung einer Lautkette auffassen, die es dann linguistisch zu analysieren gilt. Ich möchte folgende Alternative vorschlagen:
Mit den Augen beobachten wir, wie jemand geht, ißt, spricht. Mit den Ohren beobachten wir, wie jemand spricht, singt. Was er dabei tut, ist nur teilweise auch sichtbar, aber durch die Ohren wissen wir mehr. Wir wissen, "wie man es macht".
Wie wichtig das ist, fiel mir gestern ein, als ich im Freien saß und eine Amsel in meiner Nähe sehr laut sang. Diese Töne werden auf eine mir nicht nachvollziehbare Art erzeugt und haben daher etwas Abstraktes, so ähnlich wie elektronisch erzeugte Klänge. Ich wüßte nicht einmal, wie ich sie auf Notenpapier bringen könnte. Das hat nichts mit dem Hören der "Lautkette" zu tun; ich höre sie ja sehr gut. Aber es fehlt jenes andere Moment: die Beobachtung eines Verhaltens mit den Ohren.
| Kommentare zu »Stimmen« |
| Kommentar schreiben | neueste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 06.05.2013 um 07.44 Uhr |
|
Möglicherweise liegt der (oder einer der) Schlüssel im zweiten Absatz: Diese Töne werden auf eine mir nicht nachvollziehbare Art erzeugt. Sowohl das Schreiben als auch das Sprechen lassen sich lernen (d.h. nachahmen). Beim Vogelgesang oder anderen tierischen Geräuschen ist das nur sehr begrenzt möglich, und selbst wenn, ist der Erzeugungsvorgang ein anderer als beim "Original". Mir scheint in der Tat die Alphabetschrift der Grund für die Illusion von der Existenz einer Lautkette zu sein. Am besten läßt sich dies anhand eines Vergleichs von Alphabetschriften mit anderen Schriftsystemen aufzeigen, und Christian Stetter hat aufgezeigt, daß beispielsweise Japaner, die ein Silbenschriftsystem verwenden, gesprochene Sprache ganz anders analysieren als Europäer. Die Versuchung, gesprochene Sprache analog zur Alphabetschrift (Aneinanderreihung von Buchstaben) als "Lautketten" aufzufassen, ist vermutlich das Fehlen eines brauchbaren "phonographischen Urmeters", d.h. einer neutralen Referenz. Auch die verschiedenen Lautschriftsysteme sind ja nichts anderes als verfeinerte Alphabetschriften, und niemand wird ohne Sprachunterricht bzw. die Gelegenheit zur Nachahmung anhand eines Lautschriftalphabets eine fremde Sprache sprechen lernen können (das hat sinngemäß natürlich auch schon Hermann Paul geschrieben). Sprachgeschichtlich war es wohl so, daß die Alphabetschrift (auch die japanischen Silbenschriften oder sogar die ägyptischen Hieroglyphen) mit einem Bezug zur gesprochenen Sprache entwickelt wurden oder sich entwickelten, ganz einfach weil es sich um zwei Seiten einer Medaille handelte. Die Schrift hatte und hat dabei den Vorteil einer größeren Eindeutigkeit, was besonders in China von Bedeutung ist, wo viele Sprachen gesprochen werden und nur die Schrift die Kommunikation zwischen den Sprachgemeinschaften, wie notdürftig auch immer, gewährleistet. In Sprachen, die eine Alphabetschrift verwenden, scheint die größere Eindeutigkeit der Schrift wiederum die Wahrnehmung bzw. Analyse der gesprochenen Sprache beeinflußt zu haben, und sei es nur angesichts der Versuchung, die Alphabetschrift als scheinbar neutrale Referenz zu verwenden. In anderen Worten: Die Krücke wurde zum Mittel der Analyse. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.05.2013 um 15.11 Uhr |
|
Vor vielen Jahren habe ich sogar die Vermutung geteilt, daß die Segmentierung der Rede in einzelne Laute bzw. Phoneme überhaupt erst unter dem Eindruck der Schrift möglich wurde. Phoneme wären dann diejenigen Abschnitte, die man braucht, um Wörter in einer Alphabetschrift eindeutig zu fixieren. Davon bin ich aber abgekommen, nachdem ich zur Kenntnis nehmen mußte, daß die altindische Phonetik und Phonologie offenbar ohne Schrift entwickelt worden ist. Was den Vogelgesang betrifft, so könnte ich mich natürlich kundig machen, aber das theoretische Wissen ist nicht das, was ich meinte mit "mir nicht nachvollziehbar". Hunde bellen inhalatorisch, nicht wahr? Das kann ich auch, deshalb sind Hunde mir näher als Amseln ... |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 06.05.2013 um 18.31 Uhr |
|
Ein Beispiel, daß bei der Alphabetisierung einer Sprache Fehler auftreten können, ist die Geschichte des griechischen Buchstabens Beta. Aus Metrik-Untersuchungen der Ilias-Hexameter ergibt sich die Existenz des Lautes [w] während der mündlichen Überlieferungszeit vor der Alphabetisierung. Zur Zeit der Einführung des Alphabets wurde der Laut [w] nicht mehr gesprochen, folglich kein Zeichen für ihn entwickelt. Die Ilias wurde ohne das [w] aufgeschrieben. Im Mittelgriechischen wurde der Laut [w] wieder benötigt und das Zeichen für Beta als [w] gesprochen. So wurde dieser Laut ins Altkirchenslawische übernommen, und die Slawen entwickelten für den Laut [b] ein neues Zeichen in ihrer kyrillischen Schrift. Die Griechen entwickelten dagegen für den Laut [b] ein durch ein [m] erweichtes [p], also das Zeichen mp.
|
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 07.05.2013 um 08.08 Uhr |
|
Zunächst zum Vogelgesang: "nachvollziehen" kann verschiedenes bedeuten: verstehen, wie etwas funktioniert (wie der Vogel die Geräusche erzeugt); den Vorgang imitieren (nicht möglich, da die menschlichen Artikulationsmittel andere sind); dasselbe Ergebnis unter Zuhilfenahme anderer Mittel erzielen. "auf eine mir nicht nachvollziehbare Art erzeugt" war für mich unglücklicherweise nicht deutlich genug. "von mir" oder noch besser "durch mich" wäre, jedenfalls für mich, eindeutig gewesen. Daß die alten Inder fähig gewesen sein sollen, Gesprochenes auch ohne Alphabetschrift in Phoneme zu zerlegen, will ich gerne glauben, auch wenn es sich um eine phänomenale Abstraktionsleistung gehandelt haben müßte. Aber sie haben ja auch ein unschlagbar vernünftiges Ziffernsystem entwickelt. Mangels eigenen Fachwissens in Indologie deshalb einfach interessehalber die Rückfrage, ob dies als sicher gilt. Ganz unabhängig von der Antwort bleibe ich skeptisch, und zwar aus folgenden Gründen: – Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können, sowie erwachsene Analphabeten, also Menschen, die sich gleichsam im Zustand der schriftlosen Unschuld befinden, analysieren den Geräuschstrom, wie Lehrende zu ihrer Überraschung immer wieder erfahren, ganz anders als schriftsprachlich "Vorbelastete". Und weil sie alleine auf die Ohren angewiesen sind, hören sie auch mehr (z.B. den Glottisschlag). – "Laute" (Phoneme) sind Abstraktionen und lassen sich nicht sprechen. Bestenfalls kann man wohl annehmen, daß die Konstruktion von "Lauten" ein heuristischer Kunstgriff war. In China und Japan ist man auf die Silbe als kleinste "phonematische" Einheit verfallen, was mir als realistischer erscheint. Warum? Warum zählt "a" als "Laut" (Phonem), "au" als "Doppellaut" (Phonem) und "aus" als aus "Lauten" (Phonemen) zusammengesetztes Wort? – Selbst wenn die Inder ganz ohne Schrift zu einer phonologischen Analyse gesprochener Sprache gelangt sein sollten – welchen Einfluß hatte dies auf die Entwicklung der modernen Phonetik? Die Sanskrit-Texte wurden in Europa erst im 19. Jahrhundert bekannt, zu einer Zeit also, da die Verschriftung der Sprache und die Schriftsprache als Referenz bereits mehrere Jahrhunderte alt war. Moderne Lautschrift-"Aufzeichnungen" bewegen sich jedenfalls verdächtig nahe am Geschriebenen, und wenn man Analphabeten das IPA-Alphabet beibringen könnte, würden die "Aufzeichnungen" wahrscheinlich ganz anders aussehen. Man könnte es aber vermutlich gar nicht, weil die IPA-Umschrift die Kenntnis einer Alphabetschrift voraussetzt. Meine bevorzugte Metapher bezüglich gesprochener Sprache ist immer die Billardkugel: Das Gesprochene ist der Kurs der Kugel auf dem Tisch, nachdem sie vom Queue (dem Sprecher) angestoßen wurde. Phoneme sind die Berührungen der Kugel mit den Banden, durch die die Kugel eine andere Richtung nimmt. Lautschriften teilen die Banden in Skalen ein (z.B. in Zentimetern), um die Berührungspunkte der Kugeln festzuhalten, und Alphabetschriften vergröbern die Skalen noch einmal erheblich. Damit erhöht sich zweifellos die Trefferquote, aber über die Bewegung der Kugel ist damit nicht allzuviel ausgesagt. Das Problem der modernen Phonetik/Phonologie scheint mir zu sein, daß man die Banden mit der Kugel und ihrer Bewegung verwechselt. Man müßte an dieser Stelle wohl noch etwas über das Notationssystem der Musik sagen, aber das muß einstweilen warten. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.05.2013 um 13.39 Uhr |
|
Die Hethiter benutzten die akkadische Keilschrift. "Eine der Hauptschwierigkeiten der hethitischen Keilschrift ist die Schreibung von Konsonantengruppen. Da nur Schriftzeichen für Silben der Form Konsonant + Vokal, Vokal + Konsonant und Konsonant + Vokal + Konsonant vorhanden sind, können anlautende und auslautende Doppelkonsonanten sowie inlautende Trikonsonanten nicht ohne weiteres dargestellt werden. Die Schrift läßt also mehr Vokale geschrieben erscheinen, als in der Sprache tatsächlich vorhanden sind. Für den modernen Forscher ist es nicht immer leicht, in einem hethitischen Text die "echten" von den "unechten" Vokalen zu trennen." Zitat aus Friedrich, Hethitisches Elementarbuch.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.05.2013 um 16.41 Uhr |
|
Interessante Gedanken und Fragen. Ja, die Mündlichkeit der altindischen Sprachanalyse ist für meine Begriffe vollkommen sicher. Einiges habe ich in den Einträgen unter "Stämme und Wörter" schon angeführt. Die Schwierigkeit der Versprachlichung von Naturlauten war den alten Indern auch bewußt, sie hatten sogar einen Terminus dafür: avyaktânukarana (= a-vyakta-anukarana, also "Wiedergabe von Nichtartikuliertem"). Das ist viel besser getroffen als "Onomatopoiie". Ohne die phonologische Abstraktion (worüber sie sich auch im klaren waren) hätte die Inder u. a. auch nicht die Ablauttheorie aufstellen können, mit der Paninis Werk gleich loslegt. Meiner Ansicht nach war auch die Neuordnung des Alphabets, nachdem sie es übernommen hatten, nur auf der Grundlage einer vorab existierenden Phonetik möglich. Da der Grammatik unabdingbar eine bestimmte Auflistung der Phoneme vorangestellt ist (die Shivasutren), auf die sich die Grammatik dann immer wieder bezieht, muß man annehmen, daß die Grammatiker über das Repertoire ganz frei verfügten und auch niemals Laute und Buchstaben verwechselten (wie noch Grimm in seiner Deutschen Grammatik, wenn auch nur als laxe Redeweise). (Ich lasse übrigens bei Transkriptionen wie immer einige Feinheiten weg und bitte deshalb um Nachsicht.) |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 08.05.2013 um 07.01 Uhr |
|
Gibt es eigentlich klassische persische, arabische, aramäische oder kanaanäische Texte zur Phonetik? Und im Falle der Existenz von Texten aus der Blütezeit der arabischen Kultur: inwieweit bieten sie gegenüber den griechischen Klassikern etwas Neues?
|
Kommentar von Germanist, verfaßt am 09.05.2013 um 13.05 Uhr |
|
Leser ohne Arabischkenntnisse können in dem Buch von Thomas Bauer, Die Kunst der Ambiguität, Eine andere Geschichte des Islams, im Kapitel 7, Sprachernst und Sprachspiel, einiges über die Sprachwissenschaft der Araber und die Entstehung des Hocharabischen finden. Zitate: "Tatsächlich ist das erste "richtige" arabische Buch (vom Koran natürlich abgesehen) ein grammatisches Werk, nämlich die arabische Grammatik des Sibawaih, eines arabisierten Persers, der um das Jahr 793 a.D. starb. ... Die Normen der arabischen Sprache fand Sibawaih keineswegs im Koran, sondern in der Sprache der arabischen Beduinen. ... Der sensationelle, weltgeschichtlich einmalige Aufschwung der arabischen Sprachwissenschaften hatte keine religiösen Ursachen. ... In Europa sollte die Lexikographie erst im 19. Jahrhundert an einem Niveau anlangen, an dem sie in der islamischen Welt schon fast ein Jahrtausend früher angekommen war." |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 10.05.2013 um 09.14 Uhr |
|
Vielen Dank, Germanist, aber bezüglich des Themas des Tagebucheintrages wäre es doch interessant zu erfahren, wie beispielsweise die arabischen Gelehrten ihre gesprochene Sprache analysiert haben.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.01.2014 um 07.36 Uhr |
|
Seit gestern singt hier eine Amsel, was ziemlich unerhört ist, denn sie ist eigentlich erst vier Wochen später dran. Das hat über die Jahre hin nur wenig geschwankt. Allerdings ist das, was ich da höre, ziemlich schräg. Früher hat die Amsel (natürlich immer wieder eine andere) Bruchstücke aus den Klavierübungen unserer jüngsten Tochter aufgegriffen, zum Beispiel aus einer Französischen Suite von Bach. Davon kann ich jetzt nichts erkennen. Vielleicht gefällt ihr die h-Moll-Rhapsodie von Brahms nicht, oder sie ist ihr zu schwierig. Bei anderen Vogelarten ist noch ausgeprägter angeboren, daß sie singen, aber nicht, was sie singen. Sollte das mit unserer Sprache ähnlich sein? Ich glaube es nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2015 um 07.15 Uhr |
|
Dieses Jahr hat die Amsel ganz manierlich am 22.2. angefangen zu singen. Aber was ich eigentlich eintragen wollte. Der Online-Duden gibt in Lautschrift ganz systematisch Wörter wie Steckkontakt mit kk in der Mitte wieder. Das ist meiner Ansicht nach falsch. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2015 um 12.27 Uhr |
|
Der Duden schweigt sich darüber aus, wie man sich die Artikulation von kk in "Steckkontakt" vorstellen soll: Sind es wirklich zwei komplette k, wie laut Umschrift zu erwarten, oder soll es eine Verzögerung zwischen Verschluß und Öffnung geben wie bei italienischen Langkonsonanten? Auch bei "Kammmuschel" und "Nullleiter" sollen zwei Konsonanten gesprochen werden. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 04.03.2015 um 14.08 Uhr |
|
Zu erwarten wäre die Notation [k:].
|
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.03.2015 um 16.06 Uhr |
|
Beim Eintrag Druckknopf hat Duden online keine Lautschrift, sondern einen Link (Lautsprechersymbol) zu einer hörbaren Aussprache. Der Sprecher sagt dort betont langsam und deutlich Druck-knopf, also zweimal k. Deshalb denke ich, daß Duden mit der Lautschrift kk meint, das k sei doppelt auszusprechen. Das finde ich aber auch unrealistisch. Meiner Ansicht nach wird bei normalem Sprechtempo nur ein k gesprochen, und dies auch weder behaucht wie doppelte Verschlußlaute im Isländischen noch mit einem kurzen Halten wie im Finnischen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2015 um 16.26 Uhr |
|
Ich habe mich beim Bibliographischen Institut erkundigt und auch freundlicherweise sofort eine Antwort bekommen: „Die Lautschrift soll in der Tat zeigen, dass in der Standardlautung zwei gleiche Konsonanten gesprochen werden. Der Ausspracheduden hat hier als Muster eine entsprechende Darstellung beim Eintrag 'Kammmacher'.“ Ich habe mich bedankt und noch einmal nachgefragt: „Ich möchte aber doch noch einmal nachfragen, ob die beiden k bei "Steckkontakt" tatsächlich zwei getrennt angesetzte k oder wie ein italienischer Doppelkonsonant zu sprechen sind. (In welchem Fall die Transkription irreführend wäre.)“ Die Antwort kam umgehend: „Der Ausspracheduden hat keine Notwendigkeit gesehen, die 'langen' Konsonanten anders als durch Verdoppelung in der Lautschrift darzustellen. Es heißt dort auch im Abschnitt 'Zur Aussprache fremder Sprachen' für das Italienische: 'Doppelbuchstaben bezeichnen lange Laute; pp ist [pp], ll ist [ll] usw. ...' (S. 116) Wir werden bei einer Neubearbeitung mit den Autoren darüber sprechen, ob wir das künftig ändern wollen.“ Soweit dies. Im DDR-Aussprachewörterbuch (Krech u. a., 1964) wird von einer „Reduktion“ gesprochen, die dadurch markiert wird, daß das erste m in [kammacher] kursiv gesetzt ist. Es heißt in der Einleitung: „Sofern es das Sprechtempo erlaubt, soll jedoch bei Verschlußlauten eine Längung der Verschlußphase, bei Engelauten eine Längung des Lautes erhalten bleiben.“ Dadurch sollen auch „Schall-technik“ und „Schalt-technik“ unterscheidbar bleiben. Eisenberg schreibt in der Dudengrammatik § 50: „Gleiche oder homorgane Konsonanten an Morphemgrenzen werden bei Überlautung häufig getrennt artikuliert. (...) Bei Explizitlautung werden solche Doppelkonsonanten mit zeitlicher Verzögerung artikuliert: Plosive öffnen später, alle anderen Konsonanten werden lang. Beides notiert man als [kk].“ (mit einem Bogen darunter, der die beiden kk = Konsonanten verbindet). Die Notation ist aber sonst in dieser Grammatik dieselbe wie bei anderen Silbengelenken, „Steckkontakt“ also ebenso wie „Stecker“. Dazu Wolf Peter Klein: „Laut Maas (1992: 293) werden auch bei orthographischen Geminaten an Morphemgrenzen im Neuhochdeutschen keine Geminaten bzw. langen Konsonanten gesprochen, so auch Eisenberg (1998: 304f.). Die DUDEN-Grammatik (1995: 50) notiert, daß »gleiche oder homorgane Konsonanten an Morphemgrenzen (…) bei Überlautung häufig getrennt artikuliert« werden; ähnlich auch die Bemerkungen zu den »langen Konsonanten« im DUDENASW (1990: 50). Vgl. dazu auch Kohler (1995: 210f.) Bei dieser Frage neige ich dazu, der Position von Maas und Eisenberg zu folgen.“ |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 04.03.2015 um 16.29 Uhr |
|
Es scheint aber auch auf das jeweilige Wort anzukommen. Bei stockkatholisch oder stockkonservativ gibt es auf Duden online gar keinen Aussprachehinweis (außer Betonung auf dem zweiten o), aber hier kommt mir die Aussprache mit nur einem k und ohne Verzögerung doch unverständlich vor, etwa wie 'stockatolisch'.
|
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 04.03.2015 um 18.22 Uhr |
|
Die Lautschrift gibt meist das wieder, was ein ausgebildeter Schauspieler aus dem Wort machen würde. Anders wirds auch nicht gehen – wegen regionaler Ausspracheunterschiede und vor allem, weil das Ergebnis sonst oft zu abwegig wäre. Als unser Ältester schreiben lernte, las ich bei ihm einmal das Wort „Anzermann“. Gemeint war ein Nachbar namens Ernst Hermann.
|
Kommentar von R. M., verfaßt am 05.03.2015 um 07.18 Uhr |
|
Es mangelt am Bewußtsein dafür, daß hyperkorrekte Aussprache falsch ist.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.03.2015 um 04.18 Uhr |
|
Gestern sagte jemand wegnicken, und es war nicht von wegknicken zu unterscheiden. Läßt man Probanden im phonetischen Labor vorsprechen, neigen sie zu Explizitlautung, und das ist auch nicht völlig unnatürlich, weil durchsichtige Wortbildungen jederzeit in ihre Bestandteile aufgelöst werden können. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte unser Sprecherzieher (Christian Winkler in Marburg, auch Dudenautor) uns beibringen, bei Bettdecke mitten in der Verschlußphase den Stimmton einsetzen zu lassen. Das sei jedenfalls Bühnenaussprache. Ich weiß nicht, ob das je einem lebenden Wesen gelungen ist, aber den heutigen Rundfunksprechern kann man wohl bestenfalls Umgangslautung nachsagen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.09.2015 um 04.55 Uhr |
|
Im Bereich Deutsch als Fremdsprache wechseln die Unterrichtswerke einander besonders schnell ab, und sie gleichen einander inhaltlich viel stärker als in der Aufmachung. Die beigegebenen Tonaufnahmen und Videos führen meistens Umgangslautung vor, gesprochen von Menschen wie du und ich, nicht von ausgebildeten Schauspielern. Man hört also „dreienfünfzig“ (bzw. „-fümfzig“). Hinzu kommt von Anfang an normale Sprechgeschwindigkeit. Manchen wollen sogar von Anfang an Dialekte einführen, um zu zeigen, daß Deutsch eine polyzentrische Sprache ist. Ich frage mich, ob das richtig ist. Meine eigenen Erfahrungen mit dem Fremdsprachenlernen sprechen eher dagegen. Am Anfang habe ich gern eine Sprechweise, der ich Laut für Laut folgen kann. Männer- und Frauenstimmen abwechselnd darzubieten ist gerade noch annehmbar. So bemühe ich mich ja auch im Umgang mit ausländischen Bekannten, langsamer, deutlicher und "wortenger" zu sprechen, das kommt fast automatisch. Bei Kindern machen wir es ja auch. So unnatürlich ist das also nicht. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2016 um 15.53 Uhr |
|
In dem genannten Buch schreibt Rainer Dietrich: „Von den vielerlei lautlichen Äußerungen, zu denen die Ente in der Lage ist, werden einige von fast allen Arten, einige hingegen nur von wenigen beherrscht. Von den zwanzig Arten, die Konrad Lorenz (1965) vergleicht, verfügen offenbar alle über die Äußerung vom Typ EPV, das einsilbige Pfeifen des Verlassenseins. Bei nur zwei Arten, beide echte Gänse im Unterschied zu den Pfeifgänsen, beobachtet man den mehrsilbigen Kükenstimmführungslaut (MKst.) der Anserinen. Die beiden Gansarten, die gerade diese Äußerungsart lernen können, unterscheiden sich auch biologisch von den übrigen Entenarten. Aber es gibt auch biologische Gemeinsamkeiten; alle sind eben Enten und alle beherrschen das einsilbige Pfeifen des Verlassenseins.“ (Rainer Dietrich: Psycholinguistik. 2. Aufl. Stuttgart 2007:1) (Vgl. ebenso Konrad Lorenz: „Vergleichende Bewegungsstudien an Anatinen“. Journal für Ornithologie 89, 1941) Aber von "Silben" im eigentlichen Sinn kann man nur bei menschlicher Sprache sprechen. Wie viele Silben hat der Gesang der Amsel? Sie lassen sich nicht unterscheiden. Bei Vögeln gibt es manchmal erkennbare Abschnitte oder Pulse, aber keine Silben. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 12.03.2016 um 14.22 Uhr |
|
In der Dudengrammatik und in vielen anderen Werken dieser Art (Gebrauchsgrammatiken) findet man vereinfachte Abbildungen von Kopflängsschnitten, die die Stellung der Sprechorgane bei verschiedenen Lauten zeigen. Das ist in gewisser Weise verfehlt, denn für den Sprecher und damit den Leser dieser Grammatik sind die meisten lauphysiologischen Tatsachen bewußtseinsfremd. Er weiß nicht, was sein Gaumensegel oder sein Hinterzungenrücken tut. Das ist bei den sprachlichen Verhaltensweisen, von denen die übrige Grammatik handelt, ganz anders.
|
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.10.2016 um 09.30 Uhr |
|
Zum vorigen: Die Gebrauchsgrammatik enthält Regeln, die sich als Anweisungen lesen lassen: wie man das Perfekt gebraucht – oder eben gebrauchen soll usw. Das ist bei der Artikulation nur begrenzt möglich. Im Sprecher läßt sich kaum ein Bewußtsein dafür wecken, wo sein Zungenrücken den Gaumen berührt, und gewiß gar keines dafür, wie die Stimmlippen sich bewegen – oder daß er überhaupt welche hat. Will der Arzt meinen Rachen ausleuchten, bittet er mich nicht, den Zungenrücken zu senken, sondern fordert mich auf, „a“ zu sagen. Ebenso verfehlt wäre es, das Broca-Zentrum abzubilden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 16.02.2018 um 05.56 Uhr |
|
Jeder kennt wohl Menschen, die zum Beispiel nur mit einer Hälfte des Mundes sprechen, gleichsam zur Seite hin. Von einer halbseitigen Lähmung kann keine Rede sein, es handelt sich wohl um eine Angewohnheit. Ich kann mir leicht vorstellen, daß so etwas sich in der Jugend einschleift und dann beibehalten wird, so wie ich auch den Eindruck habe, daß herabgezogene Mundwinkel wenigstens teilweise einer Angewohnheit und nicht der ererbten Physiognomie (wie bei Merkel) entspringen. Aber warum kommt es dazu? Ich kenne eine Kollegin, die immer, auch in ihren Vorlesungen, mit zusammengebissenen Zähnen spricht. Darin ist sie so geübt, daß man es kaum noch bemerkt. In solchen Fällen, die eigentlich logopädischer Behandlung bedürfen, hat man den Eindruck, daß es zum Charakter der Person paßt (wie die schon erwähnte trompetenhafte Vorstülpung bei Trump). Leider habe ich noch keine Literatur dazu gefunden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.04.2018 um 11.21 Uhr |
|
Phantastisch: https://www.mpg.de/12013900/echtzeit-filme-aus-dem-koerper |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 09.08.2019 um 16.24 Uhr |
|
Zu den Einträgen über Lächeln: Es gibt erstaunlich viele Websites über das perfekte Lächeln, meistens im Zusammenhang mit Karriereförderung. Meistens wird das bekannte Zahnpasta-Lächeln angestrebt. Die Titelseiten der Illustrierten zeigen das einstudierte Zähneblecken fast ausnahmslos. Die Prominenten können es, vor allem Schauspieler und Laufsteg-Schönheiten. Manche wie eine gewisse Heidi Klum scheinen gar keine anderen Fotos von sich zuzulassen. (Bei einigen wenigen fällt auf, daß sie nie die Zähne zeigen, z. B. die Schauspielerin Mia Wasikowska.) Ich kann überhaupt nicht so lächeln, ebenso wenig wie mit Trump-Schnute sprechen. Durch die Medien ist es geradezu das prototypische Lächeln geworden, so daß man seine Unnatürlichkeit und Seltenheit im wirklichen Leben fast vergessen könnte. Weshalb mir das noch einmal einfiel: Was bedeutet eigentlich das angedeutete halbseitige Lächeln (?) Kevin Kühnerts (Mundwinkel rechts hoch)? Es wirkt auf mich arrogant, aber das ist vielleicht eine Übertragung. |
Kommentar von Stephan Fleischhauer, verfaßt am 04.02.2022 um 01.53 Uhr |
|
Was mir bei Christian Drosten immer wieder auffällt: Er versucht seine Stimme in ein unnatürlich tiefes Register zu schieben. Auf Youtube findet man Videos über "creaky voice" oder "vocal fry" (siehe auch englische Wikipedia), bei Frauen offenbar häufiger als bei Männern. Ganz extrem hört man es bei einem uralten Interview mit Joschka Fischer: http://sr-mediathek.de/index.php?seite=7&id=1085&pnr=&tbl=pf |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.02.2022 um 06.08 Uhr |
|
Das ist mir zwar nicht aufgefallen, aber es würde mich nicht wundern, wenn geübte Sprecher dem Rat folgten, möglichst im unteren Register zu bleiben. Besonders Frauen lassen sich ja oft in diesem Sinn ausbilden, was ihrer Wirkung nur gut tun kann. Frau Ciesek kann ich ebenso wie Drosten stundenlang zuhören, sie hat eine ungewöhnlich tiefe Stimme und artikuliert besser als sämtliche Moderatorinnen, richtig beneidenswert. Wir können es nicht ändern, daß wir eine hohe Stimme weniger ernst nehmen, das ist angeboren (Kinderstimme!). Nicht ernst nehmen heißt auch: ungern mit dem Kanonendonner unserer Männerstimmen dagegenhalten. Auf die ethnologischen Befunde habe ich vor längerer Zeit hingewiesen. Meine Abneigung gegen Kekulés Sprechweise habe ich schon bekundet. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 10.05.2025 um 05.17 Uhr |
|
Zu http://www.sprachforschung.org/ickler/index.php?show=news&id=1106#53194 Psychologen und Mediziner kennen verschiedene innere Uhren und Taktgeber. Kaum beachtet wird das Sprechtempo als universeller Zeitgeber. Es ist durch den Bau unserer Muskulatur begrenzt. Träume kommen uns oft viel länger vor, als sie wirklich gedauert haben können. Sie sind eben nicht an das Sprechtempo gebunden, in dem wir sie – mit gefühlter Unzulänglichkeit – erzählen. |
Kommentar von Erich Virch, verfaßt am 10.05.2025 um 15.46 Uhr |
|
Wer Texte für lautes Lesen oder gar freie Rede vorbereitet, lernt schnell, wieviel mehr Zeit für einen tatsächlichen Vortrag zu veranschlagen ist als für einen solchen „im Geiste“.
|
