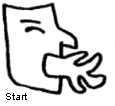


| Diskussionsforum | Archiv | Bücher & Aufsätze | Verschiedenes | Impressum |
Nachrichten rund um die Rechtschreibreform
Zur vorherigen / nächsten Nachricht
Zu den Kommentaren zu dieser Nachricht | einen Kommentar dazu schreiben
24.04.2008
Mehr Deutsch wagen
Diskussion im „Lesesaal“ der F.A.Z.
Jutta Limbach, bis vor kurzem Präsidentin des Goethe-Instituts, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch mit der Frage „Hat Deutsch eine Zukunft?“ (wir vermerkten es). Nun stellt sie im reading room der F.A.Z. ihre wichtigsten Thesen dazu vor. Hier ein Auszug:
»Gleichwohl sei die populäre Sprachkritik nicht geringgeschätzt, beweist sie doch Sensibilität für Fragen der Sprachästhetik. Dieses aus der Gesellschaft kommende Schutzbedürfnis bestätigt die These, dass die Sprache eine res publica, eine öffentliche Angelegenheit im ursprünglichen Sinne, ist. Nicht eine Akademie schreibt vor, wie das Deutsche richtig gesprochen und geschrieben wird. Die Sprachgemeinschaft ist es, die unsere Muttersprache fortbildet. Das meint auch der Bundestag, der im Streit um die Rechtschreibreform dem Bundesverfassungsgericht mitteilte, dass "sich die Sprache im Gebrauch der Bürgerinnen und Bürger ... ständig und behutsam, organisch und schließlich durch gemeinsame Übereinkunft weiterentwickelt. Mit einem Wort: Die Sprache gehört dem Volk." In der Tat: Die Muttersprache ist eine Privat- und öffentliche Angelegenheit freier Bürger.«
Link: http://readingroom.faz.net/limbach/article.php?txtid=einfuehrung
| Kommentare zu »Mehr Deutsch wagen« |
| Kommentar schreiben | älteste Kommentare zuoberst anzeigen | nach oben |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.11.2021 um 05.53 Uhr |
| Mehrsprachigkeit ist die Grundvoraussetzung für den interkulturellen Dialog, ohne den weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft und schon gar nicht die Politik auskommen. Daher ist es für jeden Bürger und jede Bürgerin Europas oder der Welt Pflicht, mehr als zwei Sprachen zu beherrschen. Jeder Schüler / jede Schülerin sollte von Beginn bis Ende der Ausbildung zwei Sprachen lernen müssen. Die Welt soll mehrsprachig bleiben – Dafür müssen wir alle etwas tun! (Jutta Limbach zum Manifest „Der Sprache die Macht!“, Festival „Die Macht der Sprache“ 2007) „Pflicht“ und „müssen“ werden mit einem scheinplausiblen „daher“ angeschlossen. Seltsamer Ton. Aber brav gegendert – von dort geht der eigentliche Zwang aus, wie wir immer deutlicher sehen. Manche Menschen brauchen gar keine Fremdsprache, viele eine, einige mehrere. Da muß man doch keine großen Reden schwingen über eine Welt, die mehrsprachig bleiben soll! |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 23.07.2020 um 06.09 Uhr |
| Trumpfen Sturmabteilung (Trump’s Stormtroopers) by Ron Jacobs, 22.7.2020 (https://www.counterpunch.org/2020/07/22/trumpfen-sturmabteilung-trumps-stormtroopers/)> (Eine Erinnerung ans Tomanische Anton Hynkels.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2016 um 11.59 Uhr |
| Die Deutsche Sprachwelt will nach dem Brexit Englisch als EU-Minderheitensprache schützen: http://www.deutsche-sprachwelt.de/berichte/pm-2016-07-04.shtml Man könnte dem Thema einen Wagen beim nächsten Faschingsumzug widmen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.07.2016 um 06.31 Uhr |
| Die Orientierung der GKS an der formalen Substantivierung entspricht dem Niveau der Volksschulehrer der 19. Jahrhunderts, wurde dann von den Grammatikern als "übertrieben" kritisiert. Fortgeschrittener ist die Einsicht in den pronominalen (vor- und rückbezüglichen) Charakter, daher "alles übrige" im Sinne von "alles andere" (wo die Reformer ebenfalls gern zum Standpunkt jener Lehrer zurückgekehrt wären und tatsächlich eine freilich unklare Sonderbestimmung hinterlassen haben). "das folgende" wirkt wie "dies:..." usw. Daneben gibt es seit je "alles, was übrig ist" und "etwas, was einem anderen folgt", also nicht verweisend, sondern tatsächlich qualifizierend, mit Großschreibung. Die Behauptung oder Unterstellung, dies sei zu subtil, wird durch die tatsächliche Entwicklung in der besseren Prosa widerlegt. Es ist sogar ein fundamentaler Unterschied, auch wenn es manchen schwer fällt, ihn namhaft zu machen. |
Kommentar von Manfred Riemer, verfaßt am 03.07.2016 um 13.50 Uhr |
| Aus dem gleichen Interview: Es gab Begriffe, die ohne jede Logik klein geschrieben wurden, wie zum Beispiel „alles übrige“. Nach der Reform wird das Wort „Übrige“ ganz logisch groß geschrieben. Ein Deutschlehrer sollte schon mal ein bißchen was von Logik gehört haben oder sich wenigstens informieren, und nicht, wenn er die Logik nicht versteht, behaupten, es gäbe keine. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 02.07.2016 um 13.15 Uhr |
| Deutschlehrer, die die Rechtschreibreform für gelungen erklären, sollte man vielleicht zu einer gewissen Nachqualifikation verpflichten: http://www.shz.de/lokales/norddeutsche-rundschau/die-reform-ist-gelungen-id14156746.html Kostprobe: Sie haben angedeutet, daß die neue Rechtschreibung viele Stärken, aber auch noch Schwächen hat. Ist die Zeit schon reif für eine weitere Reform? Es gibt tatsächlich einige Dinge, die mich stören. „Pleite machen“ wird beispielsweise heute groß und auseinander geschrieben, während „pleitegehen“ klein und zusammengeschrieben wird. Warum, ist mir nicht ganz ersichtlich. Solche Ausnahmen, die es immer noch gibt, sollte man ausmerzen. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 02.07.2016 um 09.50 Uhr |
| Lieber Herr Strowitzki, war das sarkastisch gemeint? |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 01.07.2016 um 17.57 Uhr |
| Nachdem die Briten den irischen Schulkindern ihre Muttersprache ausgeprügelt haben, ist es dem irischen Schulsystem nicht gelungen, sie ihnen wieder hineinzuprügeln. Die gesamte heutige irische Bevölkerung ist, bis auf unwesentliche Ausnahmen, im Freistaat oder der Republik zur Schule gegangen, sollte also die irische Sprache beherrschen. Aber für die meisten Iren ist das Gälische wohl so etwas wie bei uns Latein: wertvolles kulturelles Erbe, muß gepflegt werden, sollte man mal gelernt haben – aber doch nichts, um sich täglich zu verständigen! Was für ein Kampf war es, bis Radio Telefis Éireann (RTE) überhaupt Radio- und Fernsehsendungen auf Irisch brachte. Irischsprachiges Zeitungswesen beschränkt sich m.W. auf eine Seite in An Phoblacht/Republican News. Aber immerhin ist Irisch seit kurzem volle EU-Sprache, d.h. alle Dokumente sollten auch in irischer Sprache vorliegen. Insofern wäre es kein Problem, auf Englisch einfach zu verzichten. |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 01.07.2016 um 08.24 Uhr |
| Ganz praktisch gesprochen ist aber Englisch die dominierende Sprache in Irland, nicht zuletzt in Dublin. |
Kommentar von Bernhard Strowitzki, verfaßt am 30.06.2016 um 19.18 Uhr |
| In Irland ist – zumindest theoretisch – Englisch nur zweite Amtssprache nach der eigentlichen Landessprache. Auch in Malta steht das Englische nur neben dem Maltesischen. (Bekanntlich beten die stockkatholischen Malteser zu Allah!) |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 29.06.2016 um 07.31 Uhr |
| Die Schweiz punktet hier gar nicht, weil sie keinen bilateralen Vertrag mit der EU über die Freizügigkeit von Finanzdienstleistungen hat. Deshalb mußten Schweizer Banken und Versicherungen ja Tochterfirmen in London und anderswo eröffnen. All dies steht nach dem Brexit auf dem Spiel, und man darf gespannt sein, wo sich die Schweizer Institute innerhalb der kleineren EU niederlassen werden. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 28.06.2016 um 09.48 Uhr |
| Schon wahr, aber das gönnen wir ihnen, nach all den Anstrengungen. Womit punktet eigentlich die Schweiz? |
Kommentar von Chr. Schaefer, verfaßt am 28.06.2016 um 07.08 Uhr |
| Malta wahrscheinlich nicht, Irland aber schon. Dublin kann mit seiner Englischsprachigkeit gegenüber Amsterdam, Paris oder Frankfurt punkten, wenn die Banken und Versicherungsunternehmen aus London abziehen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.06.2016 um 11.19 Uhr |
| Die Deutsche Sprachwelt (= Thomas Paulwitz) versteht den Brexit-Beschluß als Gelegenheit: Nach Brexit: Deutsch als EU-Sprache stärken! Erlangen, 24. Juni 2016 – Nach dem sogenannten Brexit fordert die DEUTSCHE SPRACHWELT, den Status der deutschen Sprache in der Europäischen Union (EU) zu stärken. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU gebe es erst recht keinen Grund mehr für die EU-Kommission, die englische Sprache einseitig zu bevorzugen und die deutsche Sprache zu benachteiligen. Deutsch sei in vier EU-Staaten (Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg) und in Südtirol Amtssprache, Englisch nur noch in zweien: Irland und Malta. Deutsch werde von rund 90 Millionen EU-Bürgern als Muttersprache gesprochen, Englisch – nach dem Brexit – nur noch von rund fünf Millionen. Daher wiederholt die DEUTSCHE SPRACHWELT ihre Forderung, daß sämtliche Veröffentlichungen der EU vollständig auf deutsch vorliegen müssen. Auf zahlreichen Ebenen ist Englisch derzeit noch die einzige Arbeitssprache in der EU. Unterlagen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sind meist ausschließlich auf englisch. Bundestagsabgeordnete müssen außerdem häufig über schwierige EU-Vorlagen abstimmen, die zu weiten Teilen nicht in deutscher Sprache, sondern auf englisch abgefaßt sind. Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung mehrmals dazu aufgefordert, die EU-Kommission auf ihre Übersetzungspflicht hinzuweisen. Die Bundesregierung ist nun dazu aufgefordert, eine stärkere Rolle für die deutsche Sprache in der EU durchzusetzen. http://www.deutsche-sprachwelt.de/berichte/pm-2016-06-24.shtml Die Sprachenpolitik der EU ist eine Sache, der Brexit eine andere. Die Bundesregierung wird anderes wichtiger finden. Auch müßten die Franzosen usw. von solchen Plänen überzeugt werden; es war ja nicht die Mitgliedschaft Englands, was bisher die deutsche Sprache in den Hintergrund drängte. Außerdem könnten jene Zulauf erhalten, die schon immer meinten, am besten wäre eine Amts- oder Arbeitssprache, die niemanden bevorzugt oder benachteiligt, weil sie für alle eine Fremdsprache ist. (Latein ist vorgeschlagen worden, auch Esperantisten haben meist so argumentiert.) Irland und Malta werden aus ihrer Englischsprachigkeit keinen großen Vorteil zu schlagen versuchen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 24.12.2013 um 07.29 Uhr |
| Auf Werner Königs Aufsatz über "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." weist heute die FAZ hin. Der Text steht im "Sprachreport" (http://pub.ids-mannheim.de/.../sr13-4a.pdf). König hält also den Slogan für sehr schädlich, will die Dialektsprecher vor Diskriminierung schützen usw., gibt allerdings selbst zu bzw. ist stolz darauf, daß Baden-Württemberg und Bayern besonders erfolgreich sind (weshalb es mit der schädlichen Diskriminierung aus sprachlichen Gründen nicht so weit her sein kann - aber diesen Widerspruch erkennt er nicht). Ein Dialektologe sollte eigentlich wissen, daß gerade in mundartlich stark gegliederten Staaten die Herausbildung eines Standards, mag er historisch noch so sehr auf "Diskriminierung" zurückgehen, unvermeidlich ist. Daß ein Bewerber die Stelle eines deutschen Sprachlehrers im Ausland nicht bekommt, weil er Dialekt spricht, kommt wohl vor und ist auch nicht ungerecht. In vielen Staaten der Erde ist das so, und man hält es für zumutbar, daß die Menschen zusätzlich zu ihrer Mundart auch die Standardsprache erlernen. König erwähnt Norwegen, aber nicht Frankreich, England, Italien. Im antiken Griechenland mit seiner sprichwörtlichen dialektalen Kleinteiligkeit konnte Aristophanes einen Lacher erzielen, indem er Dialektsprecher vorführte. Der attische Dialekt wurde Weltsprache, ebenso das Lateinische aus einem Kaff namens Rom. Wie könnte es anders sein, wo wäre es je anders gewesen? König kommt mehrmals auf den norddeutschen Tach zurück, den er offenbar besonders scheußlich findet (wie meine Frau. als sie es zum erstenmal von mir hörte, ich habe es mir aber abgewöhnt...), der aber im Süden nicht Fuß fassen konnte. Aber er erwähnt nicht, daß sich die süddeutsche Aussprache seines eigenen Namens gegen die norddeutsche (Könich) immer mehr durchsetzt. Die deutsche Ausgleichssprache (im wesentlich norddeutsche Vokale und süddeutsche Konsonanten) läßt sich nicht wieder rückgängig machen, und da mundartliche Färbung überall hingenommen wird, gibt es auch keinen Grund für solche bierernsten Klagen. Überflüssig zu sagen, daß Königs Aufsatz in Reformschreibung gedruckt ist: seit Längerem usw., dagegen hat er offenbar nichts einzuwenden. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 08.03.2013 um 18.46 Uhr |
| Manchmal wird das Sprachenlernen dazu benutzt, den Lernenden eine bestimmte Weltsicht aufzudrängen: Vor dem Ende der Sowjetunion gab es deutsche Lehrbücher für die kleineren slawischen Sprachen, z.B. Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, nur von DDR-Verlagen. Darin wurde ganz ausdrücklich die Weltsicht des Sozialismus eingebaut, sodaß die Textbeispiele für Westdeutsche fast unbrauchbar waren. Auch die Vokabeln waren gespickt mit sozialistischen Begriffen. Man mußte sich auf die Grammatik und Alltagsworte beschränken. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 07.03.2013 um 21.15 Uhr |
| Die Frage der linguistischen Relativität wurde bekanntlich im Zuge der Erforschung der Indianersprachen wieder aufgeworfen. Hier hat sie eine gewisse Berechtigung, haben doch die nordamerikanischen Indianer nicht viel hinterlassen, woraus man Schlüsse auf ihre »Weltansicht« ziehen könnte. Von den alten Griechen hingegen sind Mythen, Literatur und natürlich Philosophie überliefert. Warum sollte da man da im Wortschatz oder der Grammatik ihrer Sprache nach Spuren eines Weltbildes fahnden? |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 07.03.2013 um 18.17 Uhr |
| Schon richtig, aber so ist das nicht gemeint mit der linguistischen Relativität. Dabei geht es gerade nicht um den Inhalt der Texte (den man auch in Übersetzung aufnehmen könnte, wie es ja auch geschehen ist: Aristoteles latinus usw.), sondern um die Sprache selbst als Träger einer Weltansicht. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 07.03.2013 um 14.01 Uhr |
| Man kann aber auch fragen, warum die Beschäftigung mit der griechischen Weltsicht im frühen lateinischen Mittelalter verboten war. Das Ketzerische war die Toleranz gegenüber Andersgäubigen und Andersdenkenden, die es im frühen lateinisch-christlichen Mittelalter nicht geben durfte. Das Erlernen der Sprachen unserer Nachbarländer kann dazu führen, daß wir unser in der Schule vermitteltes Geschichtsbild um dasjenige unserer Nachbarländer erweitern. Zum Beispiel ist das polnische Geschichtsbild von Deutschland in einigen Punkten diametral entgegengesetzt zum deutschen Geschichtsbild über Polen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 06.03.2013 um 17.29 Uhr |
| Ich weiß nicht, ob wir das hier schon einmal diskutiert haben. Unendlich oft wird Humboldt die Ansicht nachgesprochen, die in einer Formulierung von Jürgen Trabant so lautet: „Da nun, wie Humboldt sagt, keine einzelne Sprache die Ansichten der Welt ausschöpft, ist es wichtig, daß es so viele Sprachen wie möglich gibt, weil jede uns die Welt auf eine andere, neue Art und Weise entdecken läßt.“ Wir alle hier dürften mehrere Sprachen gelernt haben, aber haben wir dadurch die Welt auf eine neue Weise entdeckt? Man kann sich so intensiv mit dem Altgriechischen beschäftigen (von Humboldt besonders empfohlen!) wie z. B. Bruno Snell, der außerdem durchaus zu Humboldt neigt, aber hat er seine Weltansicht dadurch erweitert oder verändert? Er hat uns eindringlich die Weltansicht der alten Griechen vermittelt, aber immer aus der Sicht seiner und unserer eigenen. (Ich habe gerade "Die Entdeckung des Geistes" noch einmal besonders im Hinblick auf diese Frage gelesen; Snell spricht immer über die Griechen, nie als Grieche, glauben Sie mir!) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 30.12.2012 um 19.51 Uhr |
| Das i-Tüpfelchen in Ludwig Thomas Theaterstücken ist der übertrieben Hochdeutsch redende Norddeutsche als Witzfigur. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 29.12.2012 um 07.51 Uhr |
| In dem genannten Text, einem sehr schlechten Vortrag, wenn man es genau nimmt, behauptet Ueding auch: »Nur die Franzosen kämpfen noch gegen den Sprachimperialismus des Englischen, ihr Stolz auf die eigene Sprach- und Rede-Kultur ist ungebrochen und ihre europäische Sprachpolitik hartnäckig und kompromißlos. Sollen etwa sie mit dem Deutschen eine Sprache lernen, die sich selber schon aufgegeben hat und die man in Deutschland nicht einmal den Immigranten so recht zumuten will und die in der politischen Werbung eines ihm direkt benachbarten deutschen Bundeslandes als unwesentlich diffamiert wird? "Wir können alles außer Hochdeutsch", heißt die mit Denkarmut protzende Teufels-Parole, deren Erfolg – die Werbeagentur, die sich das ausgedacht, heimste schon einen Preis dafür ein – die Einstellung der Deutschen zu ihrer kulturellen Tradition aufs schönste denunziert. Darüber hinaus die Diagnose der Dichter ein weiteres Mal bestätigt, für die ein Landsmann Erwin Teufels – Hermann Hesse nämlich – deutliche Worte fand: "Es ist ein Fluch, in einem Volk als Dichter zu leben, das seine eigene Sprache nicht kennt, nicht liebt, nicht pflegt, nicht schützt (...). Es gibt in Europa kein andres Land, in dem man Professor, Arzt, Minister, Kult(us)minister, Akademiemitglied, Ehrendoktor, Bürgermeister und Abgeordneter werden kann, alles ohne seine eigene Sprache anständig reden und schreiben zu können."« Während Ueding also das Hochdeutsche diffamiert sieht, weil die Schwaben ohne es auszukommen behaupten, sieht der Germanist Werner König, über dessen Verteidigung der Dialekte heute die Süddeutsche Zeitung berichtet, es gerade umgekehrt: »Kritisch beurteilt König die Werbekampagne des Landes Baden-Württemberg, die damit kokettiert: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." Es ist einer der meistprämierten Slogans, den die deutsche Werbewirtschaft hervorgebracht hat. "Er hat aber großen Schaden angerichtet", sagt König. "Im Land von Schiller und Hölderlin kann man sehr wohl Hochdeutsch. Und da Schwäbisch nach allgemeiner Erkenntnis ein hochdeutscher Dialekt ist, ist der Satz schlicht und einfach falsch." Richtig hieße er laut König: "Wir können alles. Außer Norddeutsch."« Ja, aber dann wäre die Werbung so dröge wie all die anderen Anzeigen für ganze Bundesländer, die man schon Minuten später nicht mehr zuordnen kann. Soviel Bierernst ist kaum zu fassen. Es ist doch klar, daß die Allgemeinheit unter "Hochdeutsch" nicht den sprachwissenschaftlichen Begriff versteht. Und König scheint nicht zu erkennen, daß der Spruch keine Geringschätzung des Dialekts ausdrückt. Zum Liebenswürdigen am Schwaben gehört das Schwäbeln. Und für Bayern gilt ähnliches, auch wenn denen nicht so schöne Sprüche einfallen. Wie jeder weiß, darf man die beiden wohlhabenden High-Tech-Länder nicht unterschätzen, auch wenn ihren Sprechern das sterile Standarddeutsch schwer fällt. Übrigens bemüht sich König nicht, den großen Schaden zu beweisen, Ueding füllt seinen ganzen Text mit steilen Thesen ohne jeden Beweis, aber der ist ja auch Rhetoriker von Beruf. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.11.2012 um 14.40 Uhr |
| Trabant hat die Rechtschreibreform "lächerlich" genannt (Gegenworte Heft 7), aber das muß die Reformer nicht grämen, denn er macht ja trotzdem mit. Laut Vorschau heißt ein Kapitel in seinem neuen Buch Über die Bhagadvad-Gîtâ. So ein Verschreiber wäre Humboldt nicht unterlaufen, da er Sanskrit gelernt hatte. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 21.11.2012 um 13.03 Uhr |
| Inzwischen liegt auch Jürgen Trabants neues Buch bei C. H. Beck vor: "Weltansichten. Wilhelm von Humboldts Sprachprojekt". Durch das Wort "Projekt" im Titel alarmiert, habe ich mir bei Amazon die Kindle-Version angesehen. Und tatsächlich ist der 352seitige Schwinger (für knapp 40 Euro!) in Schulorthographie gedruckt. Darüber hinaus hat Trabant ein Motto von Herta Müller gewählt und schreibt auf den ersten Seiten (das ist in der Kindle-Version nicht ganz sicher auszumachen) hauptsächlich von sich, seinen bisherigen Forschungen und seinen Publikationen. So ganz nebenbei erfahren wir, daß Trabant das Buch aus bereits früher publizierten Studien zusammengestellt hat, durch Überarbeitung (und orthographische Umstellung) aber versucht hat, "das Buch zu einem Ganzen zu komponieren". Das "Sprachprojekt" ist übrigens nicht das einzige Projekt Humboldts. "Die Ehe mit Caroline von Dacheröden (1766–1829), die in einem ausführlichen Briefwerk dokumentiert ist, ist als großes Projekt einer gemeinsamen Lebensgestaltung selbstbestimmter Partner geschlechtsgeschichtlich bedeutsam." Da ist es dann auch wieder nicht schade darum, daß ich in der Kindle-Vorschau nicht mehr das 13. Kapitel lesen kann: "Unendlicher Gebrauch von endlichen Mitteln: Acht verspätete Bemerkungen über Chomskys Humboldt". Warum sollte ich etwas lesen, das "verspätet" kommt? Insgesamt sieht das Buch für mich so aus wie das, was ich eine akademische Rentnerpublikation nenne. Schade um's Papier! |
Kommentar von Argonaftis, verfaßt am 21.11.2012 um 12.04 Uhr |
| Zur griechischen Schreibung des Namens Giannis, die hier nicht wiedergegeben werden kann, siehe zu Giannis Ritsos: www.translatum.gr. Jannis ist deutsche Schreibung, Yannis engl./amerikanische. YANNI Forbidden Dreams u.a. Titel einer CD von BMG Music. In GR wird das s im Namen meistens nicht gesprochen. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 17.11.2012 um 18.23 Uhr |
| Jannis/Yannis/Giannis sind Transkriptionen von Griechisch Giannis (das zweite i ist ein Eta). Die offizielle Wikipedia-Umschrift ist anscheinend Giannis; in den einzelnen Artikeln kommen aber alle drei Schreibungen vor. Wenn der erwähnte Yannis beabsichtigt, sich in Deutschland zu integrieren, hat er aber womöglich keine Wahl, wie er seinen Namen schreibt, da die deutschen Ämter der Schreibung im ausländischen Paß folgen (wohl nicht bei Rußlanddeutschen?). [alle Angaben wie immer ohne Gewähr, da aus Wikipedia stammend] Trabant betont in dem Artikel in der SZ die Bedeutung von deutschen Sprachkenntnissen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Seine Ausführungen zu "seiner" anglofonen/anglophonen Universität verstehe ich daher als durchaus (selbst?)kritisch. Er sagt ja ausdrücklich, daß manche ausländischen Absolventen dieser Uni wegen fehlender Deutschkenntnisse Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 17.11.2012 um 18.13 Uhr |
| War das jetzt ein Coming-out von Trabant? |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 17.11.2012 um 12.05 Uhr |
| Ich wette, daß der Name "Yannis" im Griechischen mit "I" anfängt, weil er von "Iooánnäs" (Johannes) komt. Warum läßt jemand, der sich in Deutschland integrieren will, seinen Namen englisch transkribieren? Wirkt nicht glaubwürdig. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 17.11.2012 um 07.17 Uhr |
| Jürgen Trabant freut sich über die hochgeschnellte Zahl von Zuwanderern aus den südeuropäischen EU-Staaten, besonders über seinen "jungen griechischen Freund Yannis", "der nicht nur klug und kreativ, sondern auch ungeheuer liebenswert ist, und – das Allerbeste zum Schluss – er sieht auch noch sehr gut aus!" (SZ 17.11.12) Eigentlich geht es aber in dem ganzseitigen Beitrag nicht um Liebeserklärungen, sondern um den Erwerb der deutschen Sprache. Trabant ist seit seiner Emeritierung Professor an der "Jacobs University Bremen", die er anglofon nennt, woraus aber wenige Zeilen später anglophon wird. Das sitzt also noch nicht richtig. Es gefällt ihm, wie wir wissen, nicht besonders, daß zugewanderte anglophone Wissenschaftler oder "indische Bankdirektoren" "nicht im Traume" daran denken, "die Sprache von denen da unten" zu lernen. Er nennt sie "Luxusmigranten". Die Studenten der Jacobs University werden auch nicht "zum Deutschlernen ermuntert oder gar verpflichtet". Das ist natürlich ein gewisser Konflikt für Trabant, der den neuen Job ja ganz freiwillig übernommen hat und nun mit den Wölfen heulen muß, deren Heulen er seit Jahrzehnten kritisiert. Dafür entschädigt ihn die Begeisterung über die Südeuropäer: "Dass die neuen Zuwanderer schon Englisch in ihrer Berufsausbildung gelernt haben, ist ein weiterer ungeheurer Vorteil: Sie wissen, was es heißt, eine Sprache zu lernen, und wie man das macht." Na dann: "Kalos irthate stis Germania!" (Damit schließt der Aufsatz.) |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 11.09.2012 um 17.35 Uhr |
| Genaueres über die Bosnische Sprache findet man in den Wikipedia-Artikeln "Bosnische Sprache" und "Unterschiede zwischen den serbokroatischen Standardvarietäten". Übrigens haben die Balkan-Slaven schon seit dem Wegfall des Zwangs, Russisch zu lernen, erkannt, daß es sehr nützlich ist, neben Englisch auch Deutsch zu lernen, weil damit man leichter einen Job in Deutschland bekommt. Beispiel: Bosnische Krankenschwestern. Wohlhabende Bosnier schicken ihre Kinder zum Studium nach Deutschland. Interessant ist auch das Buch von Biljana Golubovic: Germanismen im Serbischen und Kroatischen. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 11.09.2012 um 14.28 Uhr |
| In der SZ vom 11.9.12 gibt Burkhard Müller einen Überblick über die Sprachenprobleme der wachsenden EU. Seltsamerweise meint er: „Das Englische ist keine europäische, sondern bloß eine globale Sprache, als Muttersprache gesprochen von lediglich dreizehn Prozent der EU-Einwohner, das heißt weniger als Deutsch oder Französisch.“ „Bloß“? Dadurch, daß Englisch in der ganzen Welt gesprochen wird, hört es doch nicht auf, eine der großen Sprachen Europas zu sein, was es ja nicht erst neuerdings ist. Hübsch ist die Anekdote zum Schluß: „Ein Übersetzer ins Bosnische wurde gefragt, ob das Bosnische denn eigentlich existiere und ob es Unterschiede zum Serbischen und Kroatischen gebe. Seine Antwort: ‚Noch nicht, aber wir arbeiten dran.‘“ Solche Beiträge haben auch etwas Müßiges, weil die Sprachenfrage längst dabei ist, sich auf ihre Weise zu erledigen. Die Klage über den Rückgang des Fremdsprachenunterrichts stimmt ja auch nicht, denn Englisch wird immer mehr gelernt. Die kleineren Völker haben das längst begriffen und denken nicht daran, die Bedeutung und Rolle des Englischen herunterzuspielen oder in Frage zu stellen. Müller bezieht sich übrigens auf einen ganzseitig abgedruckten Vortrag des Schriftstellers Robert Menasse, der in in derselben Zeitung kürzlich eine Europa-Utopie ausgemalt hatte. Kurt Kister wies ihm umgehend seine Naivität nach. Schriftsteller dürfen natürlich ihre Meinung äußern, aber besonders reich an politischer Einsicht und wirtschaftlichen Kenntnissen sind sie auch nicht. Ich hatte Menasse nur überflogen und mir gedacht, daß ich das im Wirtschaftsteil alles schon viel besser gelesen hatte. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 21.08.2012 um 07.13 Uhr |
| Ein Amtsnachfolger Zehetmairs, Thomas Goppel, hat sich im Hörfunk zur Blasphemie befragen lassen: www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1843037 Seine Unfähigkeit, auch nur einen einzigen deutschen Satz zu formulieren, scheint mir so bemerkenswert, daß ich es hier erwähnen möchte. Die Rechtschreibfehler in der Niederschrift (dass) gehen natürlich nicht zu seinen Lasten. Man sieht richtig, wie er einerseits starke katholische Meinungen ausdrücken, andererseits nichts gesagt haben will. Daher das Stammeln. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 16.06.2012 um 15.45 Uhr |
| »Selbst auf niederländisch«? Was Ammon offenbar für Burenplatt hält, hat fast halb so viele Sprecher wie das Italienische. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 13.06.2012 um 08.55 Uhr |
| Vor zehn Jahren schrieb ein Deutschdidaktiker: "Der Anteil von Leitseiten in anderen Sprachen als Englisch ist derart angestiegen, daß der Anteil englischsprachiger Homepages 1999 nur noch 62% gegenüber 84% im Jahr 1995 betrug. Der Anteil der Leitseiten auf Deutsch hat sich von 4,5 % auf 13% nahezu verdreifacht. Der japanischsprachige Anteil hat sich von 3,1% auf 5%, der französischsprachige von 1,8% auf 4% 1999 verdoppelt. Selbst auf Niederländisch gibt es inzwischen knapp 3 Mio Leitseiten." Damit ist aber kein Aufholen des Deutschen in der Konkurrenz der Weltsprachen angezeigt, sondern die Steigerung geht darauf zurück, daß mit zunehmender Verbreitung des Internets die regionalen Seiten bedeutsamer werden: man findet in kleineren Kreisen ein Publikum, auch für regionale Themen. So auch die Leitseiten jeder noch so kleinen Kommune und aller Vereine usw. Zu klären wäre, ob Ammon, der die Zahlen ermittelt hat, wirklich alle Homepages der Welt erfaßt hat oder nur den Teil, der sich hierzulande vorrangig präsentiert. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 04.03.2012 um 09.48 Uhr |
| In einem etwas wirren Artikel, der noch den Geist der Tübinger Rhetorik-Verherrlichung atmet, äußert Gert Ueding seine Besorgnis, daß wir mit dem Englischen auch den angelsächsischen neoliberalen Geschäftssinn übernehmen, also die sattsam bekannte Krämerseele dieser Leute, vor der uns schon unserer Urgroßeltern gewarnt haben. Aber etwas anderes ist mir noch aufgefallen, was ich hier kurz zitieren will: „Dieser Homo erectus nun teilte sich vor einer halben Million Jahren in zwei Linien, deren eine, diejenige des Neandertalers, auf die Ausbildung physischer Fertigkeiten in direkter Konkurrenz zur Tierwelt setzte und die lautliche Verständigung auf das Reiz-Reaktionsschema eines rudimentären Repertoires beschränkte: die Lage und Gestalt von Kehlkopf, Schädelbasis und Zunge gestattete nicht mehr. Der Neandertaler starb vor etwa 35000 Jahren aus. Die andere Linie erwies sich als die eigentlich überlebensfähige und zukunftsträchtige, der sogenannte Homo sapiens sapiens vervollkommnete seinen Stimmapparat, die Schädelbasis veränderte sich, der Gaumen erhielt seine Wölbung, die Zunge rundete sich nach hinten.“ (www.vds-ev.de) Nun, wie schon oft festgehalten wurde, läßt sich aus der Anatomie des Kehlkopfes usw. nicht schließen, ob ein Organismus sprechen konnte oder nicht. Zweifellos konnte der Neandertaler Laute von sich geben wie andere Primaten auch. Alles andere hängt davon ab, ob diese Stimmgebung unter die Steuerung durch Artgenossen gebracht werden konnte, ob es also eine operante soziale Konditionierung gab. Das läßt sich anatomisch nicht feststellen, das inzwischen gefundene FOXP2-Gen ist auch nicht schlüssig, aber die Kultur (s. Wiki unter Neandertaler) spricht doch sehr dafür, daß er sprechen konnte. Außerdem ist es falsch, aus dem Aussterben auf eine mangelhafte Angepaßtheit zu schließen. Auch Homo sapiens mußte nach der Eiszeit durch einen "bottle neck", als es nur noch wenige Exemplare gab. Das ist dann mehr oder weniger Zufall. Es gibt auch Umstände, wo alle Angepaßtheit nichts nützt. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.03.2011 um 09.06 Uhr |
| Heute hat die SZ eine Doppelseite über die Qual der Wahl zwischen den Schulfremdsprachen. Es wird richtig festgestellt, daß die Schüler heute besseres Englisch sprechen als früher (dafür hatten wir sehr viel mehr englische Literatur gelesen, aber ich finde die Entwicklung trotzdem richtig). Latein wird gepriesen, soll zu besserem Deutsch führen, na ja, vergessen wir das. Aber Jakob Osel beschreibt auch, was auf die Schüler wartet: "tückische Deponentien, die aktivisch gebildet werden, aber passive Bedeutung haben". Sehr tückisch fürwahr! Ein Diagramm zeigt, daß nur 14.000 Schüler Griechisch lernen, aber 800.000 Latein. Das ist rational nicht zu erklären. Latein fürs Lehramt gilt „derzeit als krisensichere Berufswahl“. – Da bin ich mir nicht so sicher. Wie die Wende in der Atompolitik zeigt, kann die Politik sich über Nacht ändern, und das Geschwätz von gestern kümmert die Schwätzer dann gar nicht mehr. Außerdem noch gelesen: Minister Brüderle habe sich verplappert. Ich glaube, es gibt in Deutschland keinen einzigen Menschen, der nicht der Meinung wäre, die Atomwende sei ein taktisches Manöver vor den Landtagswahlen. Das sehen auch alle Zeitungen so. Aber wenn es ein Regierungsmitglied ausspricht, ist es der größtmögliche Unfall. Das ist doch seltsam. Wir erinnern uns an die Rechtschreibreform, deren Scheitern fast ebenso flächendeckend bekannt ist, aber niemand unter den Kultusministern usw. darf es aussprechen, Wankas Ausrutscher blieb einmalig. Und noch etwas: "Ein möglicherweise beschädigter Reaktor im japanischen Atomkraftwerk Fukushima könnte nach Behördenangaben zu einer erheblich stärkeren Verstrahlung führen als bislang erwartet." – So? Ich kann mich gar nicht erinnern, daß irgendwelche bestimmten "Erwartungen" herrschten, die nun enttäuscht werden könnten. Es gab Beschwichtigungsreden von Interessierten wie damals nach Tschernobyl, und wenn die nun korrigiert werden müssen, okay, aber zu "Erwartungen" ist das nicht geworden. Wir glauben inzwischen gar nichts mehr, erwarten daher auch nichts. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 23.12.2010 um 12.12 Uhr |
| Aus einer Mail (im Ausland getippt): »als frau Limbach vor einigen jahren wortschwallartig das 'variantenwoerterbuch' vorstellte – die deutsche sprache ist ja soooo schoen! – konfrontierte ich sie damit, dass die sog. rechtschreibreform die bevoelkerung ja sehr verunsichert haette, und man inzwischen offensichtlich versuche, dies nun irgendwie wieder... – worauf sich ihre stirn bewoelkte – sowas habe ich aber gar nicht gern – und ihr blick verfinsterte. (ich hielt das eigentlich fuer eine anmerkung, sie jedoch offensichtlich fuer eine konfrontation.) sie befand es nicht einmal fuer notwendig, ein konziliantes wort fallenzulassen. etwas anderes als jubel zum vorgeschriebenen thema war eben nicht vorgesehen.« |
Kommentar von R. M., verfaßt am 15.12.2009 um 21.29 Uhr |
| Kommt drauf an, von welchen Immigranten die Rede ist. Die höherqualifizierten, die von irgendwelchen Weltkonzernen, ihren Regierungen oder Forschungsinstituten in deutschsprachige Lande gesandt werden, verzichten zum Teil durchaus auf den Spracherwerb, da sie ihre Zeit hier als begrenzt ansehen und ihnen von den beflissen weltläufigen Eingeborenen vermittelt wird, daß das Deutsche ohne Belang sei. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 15.12.2009 um 15.05 Uhr |
| Jürgen Trabant kritisiert in der SZ vom 15.12.09 das Abwandern ins Englische, besonders durch immer mehr deutsche Privatschulen mit Unterrichtssprache Englisch. Er konstruiert auch einen Zusammenhang mit der Unwilligkeit der Immigranten, Deutsch zu lernen, aber das ist wohl frei erfunden. Die Ausländer der hier gemeinten Unterschicht (sozusagen der "Sarraziner") würden auch dann kein Deutsch lernen, wenn sie jenes Abwandern ins Englische nicht beobachteten (was sie ja wohl auch kaum tun). Bedeutsamer ist, daß Trabant nun nicht gegen staatliche Sprachenpolitik und – wie bei früheren Gelegenheiten – gegen das Schulsprachenangebot polemisiert, sondern gegen den Elternwunsch. Er fragt nicht, warum die Eltern ihre Kinder zum Englischen erziehen. Sie treffen doch eine urdemokratische Entscheidung. Welche Gegenargumente kann er ihnen bieten? Er spricht nur von nationaler Identität und verweist auf vage historische Beispiele, daß Fremdsprachigkeit den Deutschen nicht gut bekommen sein soll. Leibniz' oder Humboldts französische Schriften seien weder Bestandteil der französischen noch der deutschen Literatur geworden usw. (Aber beide haben doch durch ihre französch verfaßten Werke sehr stark gewirkt?) |
Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 25.08.2008 um 09.58 Uhr |
| Noch einer, der anscheinend auf Sicks Erfolgszug aufspringen will, ist Marc Bielefeld: "We spe@k (speak) Deutsch: ... aber verstehen nur Bahnhof - Unterwegs im Dschungel unserer Sprache." bei Heyne erschienen, ISBN 3-453-60085-1 Auf Sick spielt er ohne Namensnennung zweimal höchst nebenbei und abfällig an und findet ihn wohl viel zu oberflächlich, er dagegen will richtig tief schürfen und ein dickes Brett bohren. Sein Hauptthema ist die Anglisierung, über die er mit wachsender Entrüstung in vielen Quartieren stolpert. Nicht Amüsement, nicht Ironie ist sein Tenor, sondern er gibt sich ehrlich entsetzt und prangert mit zahllosen Beispielen pausenlos an. Ermüdend eigentlich. Relativ am besten sind seine Beiträge über Jugendsprache und ihren Zusammenhang mit Musik. Da referiert er Gespräche und wertet nicht andauernd. Auf der letzten Seite verhilft ihm Schiller, den er auferstehen läßt, überraschend zu einer etwas anderen Sicht der Dinge. Mit Limbach und Sick und anderen, die heute über Sprache schreiben, und nur deshalb ist das Buch hier zu erwähnen, teilt Bielefeld aber die Marginalisierung der R-Reform und ihre Verniedlichung, sie ist ihm kaum ein paar Worte wert. Aber er schreibt brav reformiert, wenn auch anscheinend mit der Korrektor-Einstellung "konservativ", also eher unauffällig, und immerhin ohne falsches daß oder das. Vielleicht ist das aber die Linie von Heyne und er hat sich selber gar nicht drum geschert. |
Kommentar von Literaturkritik.de, 21. August 2008, verfaßt am 24.08.2008 um 23.25 Uhr |
| (Hinweis: Der Link zu www.sprachforschung.org am Ende dieses Textes ist im Original nicht vorhanden. – Red.) Deutsch – hierzulande und anderswo Jutta Limbachs verstreute Bemerkungen zur deutschen Sprache Von Gerhard Müller Dieses Büchlein ist keine germanistische beziehungsweise sprachwissenschaftliche Abhandlung, sondern ein Essay zu aktuellen Fragen des Deutschen, verfasst von Jutta Limbach, vormals Berliner Senatorin, von 1994 bis 2002 Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, später Präsidentin des Goethe-Instituts. Ihre Verdienste in dieser Funktion wurden in einer Verlautbarung des Auswärtigen Amtes bei ihrer Verabschiedung am 31. März 2008 so resümiert: "Die Zusammenarbeit von Auswärtigem Amt und Goethe-Institut war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Nach einer Zeit der Einschnitte und Kürzungen seit Mitte der 90er Jahre ist es gelungen, mit einem gemeinsamen Reformkonzept die Zukunft des Goethe-Instituts neu zu gestalten. In Limbachs Amtszeit fielen die Eröffnung eines Goethe-Lesesaals in Pyöngyang (Nordkorea) und die Wiedereröffnung des Instituts in Kabul, die Partnerschaft bei verschiedenen Kulturjahren (zuletzt ,Deutschland in China'), und schließlich ,die Wiederentdeckung der Sprachvermittlung als eine der zentralen Aufgaben des Goethe-Instituts' (Steinmeier)." Als Motto hat Limbach ihrer Schrift vorangestellt: "Dieses Buch ist als ein bescheidener Dank für das schönste Ehrenamt gedacht, das die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben hat." Entsprechende Schlüsse darf man ziehen. Jutta Limbach hat ihre Ausführungen in sechs Kapitel gegliedert. Im ersten schlägt sie gleich den hohen Ton an, der ihre Darstellung ins Grundsätzliche führen und der traditionellen Hochkultur verpflichten soll: Detailkritik und fachliche Einwände mögen unterbleiben (Karl-Heinz Göttert hat mit Recht von "Einschüchterung per Autorität" gesprochen). "Babylon - eine Strafe oder eine Chance?", so nennt sie das erste Kapitel. Hier verweist die Autorin auf das von der EU ausgerufene Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs (2008) und das Unionsziel der Mehrsprachigkeit, wofür eigens ein Kommissar eingesetzt worden sei - und unter diesem Aspekt wird ihre Veröffentlichung, die meistenteils bildungsbürgerlich wolkig bleibt, konkreter und greifbar. Das Kapitel über die Muttersprache versammelt, man verzeihe die Drastik, eine Reihe von Assoziationen zur Sprache generell und zur Situation der deutschen Gegenwartssprache, die kaum mehr sind als schale Versatzstücke einer Feiertagsrhetorik. So heißt es etwa unter der Zwischenüberschrift "Die Muttersprache als geistig-seelische Heimat": "Die erste Seele gewinnt der junge Mensch mit dem Erlernen der Muttersprache. [...] Über die Sprache erfährt der Mensch seine Möglichkeiten und seine Grenzen." Gegenwärtige sprachpflegerische Bemühungen werden als "Versuche linguistischer Kammerjäger" und Zeichen "kulturpessimistischen Jammerns" abgetan, insbesondere die Anglizismenkritik; zugleich aber (es zeigt sich ein nicht bewältigter Widerspruch) werden Wörter wie relaxen und downloaden (beides doch harmlose Neologismen) als "sprachliche Ärgernisse" getadelt, und Limbach kommt den von ihr abgekanzelten Puristen im Grunde entgegen: "Und in der Tat treibt die zum Teil hausgemachte Produktion von Anglizismen mitunter kuriose Blüten." Einigermaßen konsistent ist hier wenigstens der Abschnitt über "Sprache und Staat - Deutsch ins Grundgesetz?" Als erfahrene Richterin führt sie aus: "Wer einmal berufsmäßig die Tausende beim Bundesverfassungsgericht eingehenden Beschwerden gesehen hat, dem kann angesichts des Eifers der Sprachpuristen angst und bange werden." Sie verneint die jüngst wiederholte Anregung ("zeugt nur von Kleinmut"), der deutschen Sprache Verfassungsrang einzuräumen. Ihre Ausführungen über "Das Deutsche in einer offenen Weltgesellschaft" streifen verschiedene Fragen (Sprachpolitik, Migration, die deutsche Geschichte, die "68er-Generation") und bleiben ebenfalls rhapsodisch und vage. Klar wenigstens ist folgende Aussage: "Doch die bittere Erfahrung, die Millionen von Menschen mit deutschem Vormachtsstreben gemacht haben, sollte nach wie vor die Methodenwahl und Tonart unserer Sprachpolitik leiten." Die Politikerin und Kulturfunktionärin erkennt man an Sätzen wie diesen: "Was die Franzosen dürfen, nämlich La Grande Nation spielen, steht uns Deutschen wegen Auschwitz nicht gut an. Gleichwohl ist es legitim, das Lehren der deutschen Sprache zu einem vorrangigen Ziel der auswärtigen Kultur- und Bildungsarbeit zu machen." Limbach lehnt eine "Deutschpflicht" im Hinblick auf eine sogenannte "Pausensprache" ab und plädiert für "freie Übereinkunft". Zustimmung dürfte und sollte die These erfahren, zugewanderte Minderheiten darin zu unterstützen, ihr kulturelles Erbe und ihr Sprache zu pflegen. Parallel gelte es, dass vor allem den Kindern aus zugewanderten Familien helfen würde, wenn die Lehrerinnen und Lehrer der Vor- und Grundschule ihrer Sprache mächtig wären. "Das Erlernen der türkischen Sprache [...] sollte mit Prämien oder einer höheren Gehaltsgruppe honoriert werden", so Limbach. Man bemerkt, nebenbei, wiederum, dass hier keine Sprachwissenschaftlerin, sondern eine politisch aktive Juristin spricht. Was beileibe kein prinzipieller Einwand sein soll. Natürlich darf Limbach das, und ihr Essay darf auch allgemeines Interesse beanspruchen, denn die von ihr angesprochenen Themen sind aktuell und diskussionswürdig. Zur Sprache darf sich jeder äußern. Immerhin wäre zu überlegen, was passierte, sollten sich Germanisten zu Fragen der Jurisprudenz, Medizin oder Chemie öffentlich vernehmen lassen. Das längere Kapitel über "Deutsch als Fremdsprache" ist, wie eingangs angedeutet, konsistent und lesenswert; es stellt auch das Herzstück des Büchleins dar. Allerdings ist der erste Satz merkwürdig und fraglich: "Der Traum von der Weltsprache ist für die deutsche Sprache ausgeträumt." Wer hätte ihn denn, zumindest in den letzten Jahrzehnten, ernsthaft geträumt? Gegen wen argumentiert Limbach an? Immerhin, Limbachs Eintreten für Mehrsprachigkeit innerhalb der EU und ihr Plädoyer für die "persönliche Adoptivsprache", also einer Sprache, die nicht Muttersprache und internationale Verkehrssprache ist und aus freien Stücken gelernt wird, sind plausibel. Freilich bleibt der Schluß offen : "Was immer dessen [= des europäischen Sprachenregimes] Ergebnis sein wird - drei, vier oder fünf Arbeitssprachen -, das Europa der Zukunft wird nicht einsprachig sein. Bei der Abwehr einer sprachlichen Monokultur kommt Deutschland und Frankreich eine besondere Rolle zu. [...] Es gilt Fantasie zu entwickeln, wie sichergestellt werden kann, dass auch die Sprachen lebendig bleiben, die nicht in den Genuss kommen, Arbeitssprache des vereinten Europas zu sein." Das letzte Kapitel darf getrost überblättert werden. Wie in den Einführungsabschnitten sind hier kaum mehr als leere Phrasen zum "geschätzten Kulturgut" im Allgemeinen und im Besonderen niedergelegt, etwa die überaus lehrreiche Bemerkung: "Aus Österreich und der Schweiz stammen viele große Werke der deutschsprachigen Weltliteratur. Hier sei nur auf Robert Musil und Gottfried Keller verwiesen." Zudem zeigt das Buch etliche fachliche Mängel und Inkorrektheiten. So wird "Denglisch" umstandslos mit "Chinglish, Hinglish, Singlish, Spanglish" gleichgesetzt; Johann Gottfried Herder wird mit der Romantik in einem Atemzug genannt; es ist indiskutabel, in einem Text zum gegenwärtigen Deutsch einen Ausdruck wie Globalisierung als "Wortungetüm" zu apostrophieren. Sprachreinheitsbestrebungen werden erst für das Ende des 18. Jahrhunderts angesetzt, oft werden Autoren, die sie zitiert, im Literaturverzeichnis, das es immerhin gibt, nicht vermerkt; die Ausführungen zur Rechtschreibreform sind unvollständig und irreführend. Offenbar gab es kein sachkundiges Lektorat. Immerhin erfährt man, wie man heute korrekt "gendert": Man kombiniere "jedermann und jede Frau" und schreibe, werden Beispiele benötigt, "die Dichter und Denkerinnen, die Künstler und Journalistinnen", "Wirtschaftskapitäne und Urlauberinnen". Jutta Limbachs Essay wurde von der FAZ in ihrem Online-Lesesaal vorgestellt und erfuhr dabei weitgehend freundliche Zustimmung. Auch Sprachwissenschaftler wie Martin Gauger, Helmut Glück, Karl-Heinz Göttert, Jürgen Schiewe und Jürgen Trabant meldeten sich zu Wort. Das Büchlein wurde indessen weniger als sprachwissenschaftliche Facharbeit wahrgenommen denn als Beitrag einer prominenten Autorin zu aktuellen Fragen der Sprach- und Sprachenpolitik. Zur Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache hat sich insbesondere Helmut Glück geäußert (so etwa in der FAZ vom 25. 4. 2008). Als neuere linguistisch verpflichtete Publikation muss Jürgen Trabants Buch "Was ist Sprache?" (München 2008) herangezogen werden. Den kritischen Rezensionen Thomas Steinfelds ("Süddeutsche Zeitung", 27. Mai 2008) und Theodor Icklers (siehe unter www.sprachforschung.org vom 3. Juli 2008) vermag man sich eher anzuschließen. http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=12200 |
Kommentar von Rominte van Thiel, verfaßt am 30.07.2008 um 18.45 Uhr |
| Ich weiß nicht, ob es auf diesen Seiten schon erwähnt wurde: Das Buch von J. Trabant ist erfreulicherweise traditionell geschrieben. (Ich habe erst begonnen zu lesen, aber beim Blättern bin ich schon darauf gestoßen, daß er an einer Stelle deutlich gegen die Reform Stellung bezieht.) |
Kommentar von NZZ, 24. Juli 2008, verfaßt am 28.07.2008 um 01.35 Uhr |
| Sprache und Weltsicht Deutsch zwischen Dialekt und Globalesisch – Zwei neue Bücher Stefana Sabin Vielleicht haben die immer wieder aufflackernde Auseinandersetzung um die Rechtschreibreform, die alltäglich gewordene Erfahrung von Anders- und Mehrsprachigkeit und nicht zuletzt die Verbreitung des Englischen die Öffentlichkeit für Sprachfragen sensibilisiert. Sprachpolitik ist – ob patriotisch verbrämt oder wissenschaftlich aufgeklärt – Teil einer Diskussion geworden, die längst nicht mehr in den akademischen Elfenbeintürmen, sondern in den Massenmedien geführt wird. Entsprechend ist das neue Buch von Jutta Limbach, der ehemaligen deutschen Verfassungsrichterin und gewesenen Präsidentin des Goethe-Instituts, mit Aufmerksamkeit aufgenommen worden. In «Hat Deutsch eine Zukunft?» greift Limbach das Sprachunbehagen auf und diskutiert die Chancen des Deutschen, dem Druck des Englischen und der Konkurrenz anderer Sprachen standzuhalten. «Der Traum von der Weltsprache ist für die deutsche Sprache ausgeträumt», weiss die Autorin, empfiehlt aber dennoch, in den europäischen Behörden den Anspruch auf den Gebrauch des Deutschen nicht vorauseilend aufzugeben. Dabei lehnt Limbach Sprachpurismus und erst recht staatlich sanktionierte Regelungen nach französischem Vorbild ab. Sie beklagt die grassierende Sprachschlamperei, für die sie implizit die ständige Präsenz des Englischen verantwortlich macht – meint aber zugleich, dass Englisch die erste Fremdsprache bleiben müsse. Wenn sie dann empfiehlt, neben dem Englischen eine «Adoptivsprache» zu lernen, so ist das nur ein suggestiver Name für eine zweite Fremdsprache, wie sie überall gefordert und auch schon vielerorts gelehrt und gelernt wird. Dass es für sprachliche Integration der Einwanderer plädiert und zugleich verlangt, ihnen «Wege zum Erlernen und Erhalt der Muttersprache zu eröffnen», gehört zu den politisch korrekten Abwägungen, die dem Buch die Brisanz nehmen. Limbach stellt keine sprach- oder kulturpolitischen Thesen darüber auf, wie denn die Sprache als «geistig-seelische Heimat» zu erhalten, gar zu schützen wäre, sondern will glauben machen, dass die europäische Mehrsprachigkeit auch die nationale Sprachpflege sichern werde. Dass die Abhandlung ein wenig kraftlos wirkt, liegt auch an ihrem gelegentlich bürokratischen Ton, der mehr nach Verfassungsgericht als nach Goethe-Institut klingt. Dagegen ist der Ton des Berliner Linguisten Jürgen Trabant in seinem Buch «Was ist Sprache?», zu dem der Autor frühere Aufsätze zusammengefasst und überarbeitet hat, geradezu leidenschaftlich. Ihm gilt Sprache als «Distinktion der Spezies», die nicht nur als kulturelles, sondern auch als natürliches Gut vor dem Aussterben geschützt werden muss. Wie Limbach sieht Trabant in der Sprachenvielfalt ein besonderes europäisches Merkmal. Anders als Limbach bezieht er deutlich Position gegen den unnötigen Gebrauch von Anglizismen im Alltag, gegen den (seiner Meinung nach) übertriebenen Englischunterricht in den Schulen und gegen das verlogene Erfolgsversprechen, mit dem das Erlernen des Englischen für gewöhnlich verbunden ist. Trabant wendet sich entschieden gegen das «Globalesische», wie er das Weltenglisch nennt, als verbindende europäische Sprache und tritt – von der humboldtschen Überzeugung von der Sprache als Weltansicht geleitet – für Mehrsprachigkeit ein. Dass der Regionalismus die nationale Sprache schwächt und deren Geltungsbereich zwischen lokalem Dialekt und globalem Englisch schrumpft, ist wohl nicht so unzweifelhaft, wie Trabant meint. Am Beispiel der deutschsprachigen Schweiz glaubt er aber zu erkennen, wie die Hochsprache Deutsch verschwindet und stattdessen sich das «Schwyzerdütsch» als Alltagssprache und das Globalesische als Arbeitssprache etabliert. Dass Globalesisch die Wissenschaften erobert, beunruhigt Trabant besonders. Nicht zufällig schliesst er in seine Darstellung neben Skizzen über Sprachursprung und Spracherwerb, über Sprache und Denken sowie über das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auch eine Kurzgeschichte des Lateinischen als europäischer Sprache der Wissenschaft ein. Im Unterschied zu Limbach scheut Trabant vor Polemik nicht zurück. Auch deshalb ist sein Buch, dessen inhaltlicher Reichtum über gelegentliche Gemeinplätze und Redundanzen hinweglesen lässt, anregend. Jutta Limbach: Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt. C. H. Beck, München 2008. 112 S., Fr. 26.80. Jürgen Trabant: Was ist Sprache? Ebd. 2008. 320 S., Fr. 26.90. (Link) |
Kommentar von Karin Pfeiffer, verfaßt am 24.07.2008 um 16.56 Uhr |
| Inflation der Worte „Wohl noch nie ist in deutschsprachigen Ländern ein so gutes Deutsch von einer so großen Zahl von Menschen gesprochen und geschrieben worden.“ (Jutta Limbach) Über diesen Satz habe ich des öfteren nachgedacht. Sichtweise und Einschätzung Limbachs irritieren mich gleichermaßen. Quantitativer Anstieg – wovon auch immer – wird nicht zwingend mit einer qualitativen Verbesserung gekoppelt sein, sondern eher umgekehrt. Als Tatsache kann wohl gelten: die neuen Medien haben verschiedene Formen der Kommunikation nicht nur erleichtert, sondern auch enorm beschleunigt. Eine unvorstellbare Flut schriftlicher und mündlicher Äußerungen ergießt sich in die Öffentlichkeit. Man fragt sich, ob diese Erscheinung nur positive Auswirkungen haben werde. Das kaufmännische Prinzip von Angebot und Nachfrage kann auf so gut wie alle Vorgänge angewendet werden. Leicht und in großer Menge Verfügbares verliert an Wert. Das Überflüssige wird daher – als wenig Begehrtes – auch weniger gepflegt. Für seinen „Besitz“ wird sich niemand freiwillig anstrengen wollen, wozu auch, wenn es auch für einen „Appel und ein Ei“ zu haben ist! Triviale und niveaulose Formen des verbalen und schriftlichen Austausches haben wahrlich ein nie gekanntes Ausmaß angenommen – doch ich mag hinter dem Telegrammstil der „SMS-Stammeltexte“ wenig Sprachkultur erkennen, und wenn schon, dann sicher keine gehobene. Ebensowenig gebildet klingen die Botschaften über Mobiltelefon, zu deren Zuhörer man gezwungenermaßen selbst an stillsten Orten wird, die ursprünglich zu dezenten Verrichtungen vorgesehen sind. Das Schreiben per Hand wird kaum noch gepflegt, und auch hier mache ich mir so meine Gedanken. Ermöglichen nicht die differenzierten kleinmotorischen Bewegungen und das „langsame“ Schreiben einen qualitativ höheren und emotionalen Zugang zur Sprache? Sind nicht die besseren Schreiber auch die besseren Leser? Prägt nicht alles zusammen die Schriftkultur? Simsen ist für mich nicht Schreiben, es überlappt sich mit dieser Kulturtechnik nur in Randbereichen. Welche Entwicklung sich durch die neue Technologie ergeben wird, ist kaum abzuschätzen. Die Intelligenz im Umgang mit Schriftkultur wird sicher nicht aussterben, aber daß sie auf dem jetzigen Wege befördert werden solle, erscheint mir doch höchst unwahrscheinlich. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 20.07.2008 um 05.46 Uhr |
| In einem Leserbrief an die SZ vom 19.7.08 (als Antwort auf einen Artikel von Peter Eisenberg) jammert Lutz Götze mal wieder über den „beklagenswerten Zustand“ der deutschen Sprache. Er belegt das, wie seit vielen Jahren, mit dem Hinweis auf Bewerbungsschreiben von Haupt- und Realschülern und fordert eine wissenschaftliche Sprachpflege und andere Maßnahmen gegen den Sprachverfall. Nur, was haben die Schreibschwächen der Hauptschüler mit dem Zustand der deutschen Sprache zu tun? Das ist eine Frage des Deutschunterrichts. Jutta Limbach schrieb kürzlich: „Wohl noch nie ist in deutschsprachigen Ländern ein so gutes Deutsch von einer so großen Zahl von Menschen gesprochen und geschrieben worden.“ So kann man es also auch sehen. Götze ist übrigens als heftiger Verfechter (und erfolgreichster Vermarkter) der Rechtschreibreform in ihren verschiedenen Fassungen mitverantwortlich für die orthographische Verunsicherung, die er jetzt beklagt. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 03.07.2008 um 18.40 Uhr |
| Die fatale Verfassungsgerichtsentscheidung sieht Frau Limbach vermutlich nur deshalb kritisch, weil sie seinerzeit vom anderen Senat gefällt worden ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 03.07.2008 um 17.10 Uhr |
| Um auf Jutta Limbachs Buch zurückzukommen: Limbach sieht die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zur Rechtschreibreform und den ganzen staatlichen Eingriff kritisch, aber das Buch ist in Reformschreibung gedruckt. Ihr einziges Beispiel (zweimal angeführt) ist "Schifffahrt mit drei f" – was immer auf ein Lächerlichmachen der Reformkritiker hinausläuft. Sie sagt: „Es war nicht Sache des Gerichts, die Notwendigkeit, den Nutzen, die Güte oder die Logik der Reform zu überprüfen.“ Genau dies hat das Gericht aber doch getan, indem es feststellte, der diesbezüglichen Einschätzung durch die Kultusminister sei nicht zu widersprechen. Sie lobt auch den Bundestag: „Die Sprache gehört dem Volk.“ Aber sie zieht aus dem ganzen Unglück keine Folgerungen für sich selbst. Die Strafe folgt auf dem Fuß: „Klüger wäre es, dass (!) Hirn für einen Kompromiss zu strapazieren.“ Limbach schreibt auch: „Solche Aktionen sind insbesondere dann Erfolg versprechend, wenn ...“ Wenn es kein Druckfehler ist, bereichert Limbach die deutsche Sprache um das Wort "Jammeriade" (32). Dem Buch hätte die Hand eines Lektors gutgetan. Limbach bringt Zitate mit ermüdender Gleichförmigkeit in die Form: „Auch unsere Muttersprache ist – so treffend Jürgen Spitzmüller – kein einheitliches Gebilde“. Die Ausdrucksweise ist auch sonst oft ungeschickt und voll unklarer Bezüge. „Das Kanakische dürfte auch weniger mit Sprachdefiziten als mit dem Wunsch zu erklären zu sein zu provozieren.“ Plastikwörter sind nicht selten ("Diskussionsprozess" statt Diskussion). "Das wäre ein paradigmatisches Projekt" (= beispielhaftes Vorhaben). Das Buch ist feministisch korrekt abgefaßt, meist nach dem Muster "Politiker und Wissenschaftlerinnen". Zweimal kommt das kalauerhafte "jedermann und jede Frau" vor. „Anfang des 20. Jahrhunderts war Deutsch über die Philosophie hinaus Wissenschafts-Weltsprache.“ (67) Diesem Satz widerspricht Peter Eisenberg in der SZ vom 3.7.08. (Richtig ist aber doch, daß vor dem Ersten Weltkrieg kein deutscher Wissenschaftler, der etwas Wichtiges zu sagen hatte, auf den Gedanken gekommen wäre, es nicht auf deutsch zu sagen.) Die „Herausforderungen“ (nach challenges, statt Aufgaben) sind schon so automatisiert, daß Limbach schreibt: „Die Kenntnis mehrerer Sprachen sei eine gute Grundlage für das Erlernen zusätzlicher Sprachen, wenn die Notwendigkeit das herausfordert.“ Die ständig wiederholte Behauptung, das Erlernen fremder Sprachen fördere die „Selbsterkenntnis“ oder was auch immer, ist ohne jede Grundlage, mag sie noch so bedeutsam klingen. Ähnlich leer ist daher auch der Schlußsatz: „Hätten wir auf Erden nur eine Sprache, wir hätten uns bald nichts mehr zu erzählen.“ Ein überflüssiges Buch ohne klaren Gedankengang. Sie weiß ja auch keine Lösung für das "Sprachenregime" im künftigen Europa mit technisch unmöglichen 23 Sprachen (= 506 Sprachenpaare). So tappt sie zwischen Einfällen umher, welche Sprachen Arbeitssprachen sein sollen: die meistgesprochenen Sprachen, die grenzübergreifenden Sprachen, die Sprachen der Gründungsmitglieder, wenigstens auch eine slawische Sprache (Polnisch – aber kann man Italienisch oder Niederländisch dann draußenlassen?). Jeder Europäer solle eine Fremdsprache "adoptieren", es soll aber möglichst nicht Englisch sein usw. – lauter folgenlose Phantasien. |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 03.07.2008 um 15.42 Uhr |
| #6886: Ich nenne sie "Erweiterungen" (und das ist für mich offiziell genug), und die haben wir auch im Genitiv und im Dativ: des Lebens froh sein; jemand(em) gleich sein. — Was wäre übrigens eine sinnvolle Erklärung des Unterschieds zwischen "Objekt" und "Ergänzung" (Das ähnelt ihm <–> Das ist/sieht ihm ähnlich; ich kann diesen Menschen nicht leiden <–> ich bin diesen Menschen leid)? |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 03.07.2008 um 14.28 Uhr |
| Ich muß mich berichtigen: Adjektive konnten schon bisher "Ergänzungen im Akkusativ" haben, z.B. "das ist die Mühe nicht wert; ich bin diesen Menschen leid" (aus Der kleine Duden, Deutsche Grammatik, 1988). Weil Adjektive und zu Adjektiven gewordene Partizipien offiziell keine Akkusativ-"Objekte" haben, heißen sie dann "Ergänzungen" im Akkusativ. |
Kommentar von jueboe, verfaßt am 03.07.2008 um 11.38 Uhr |
| Besonders ärgerlich ist es, wenn der Dummschrieb unter der Flagge von Kunst und Kultur segelt. In der Kunsthalle Bremen findet z.Zt. eine Austellung über den Maler Gustave Caillebotte statt. So darf man im Internet (www.ueber-das-wasser.de) und auf vielen Plakaten in Bremen folgendes lesen: Über das Wasser Gustave Caillebotte - Ein Impressionist wieder entdeckt |
Kommentar von Karin Pfeiffer-Stolz, verfaßt am 02.07.2008 um 23.56 Uhr |
| Die Folgen der Rechtschreibreform Zur Zeit lese ich ein Buch, das aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzt ist. Übersetzungen leiden nach meiner Einschätzung an grotesken Verkrümmungen der Reformkrankheit, woran auch immer dies liegen mag (mit Blick auf den gebeutelten Berufsstand der Übersetzer eigentlich unbegreiflich). Wüßte der Autor, welche Verstümmelung sein Werk hinnehmen muß, er wäre mit Recht entsetzt. Das Thema seines Werks wendet sich nämlich gerade gegen jene Ideologie des Machbarkeitswahns, die uns den quälenden Moralismus beschert, mit welchem die Welt in Gut und Böse geteilt wird; und nach dieser Machtpolitik der Schwarz-Weiß-Malerei müssen die Bösen nun einmal in der Hölle schmoren ... Aber das nur nebenbei. Da mir das eben erwähnte Werk inhaltlich viel bedeutet, lese ich es trotz seiner schrecklichen Rechtschreibung. Die Übersetzer schrecken vor nichts zurück, fühlen sich einzig der Linie von 1996 verpflichtet. Das ist ein Produkt der Tagesroutine. Man tut das, von dem man glaubt, es wäre richtig. Wo käme man hin, würde man sich über alles eigene Gedanken machen! Wer von dieser Bequemlichkeit frei ist, werfe den ersten Stein. Machthabende sollten dies in Betracht ziehen. Ein einmal ins Wasser geworfener Stein zieht Kreise, ob man das nun gewollt hat oder nicht. Die Natur fordert sich selbst ein. Dieses Wissen scheint Reformern und Politikern abzugehen. Es würde demütig machen. Man kann nicht alles einfach nur mal so ausprobieren und dann wie im Spiel sagen: war nicht so gemeint, jetzt alles rückwärts! Was die Reform der Rechtschreibung betrifft: Die meisten Menschen denken, einmal umlernen, das reicht. Einmal Geld ausgeben für Duden und Korrekturprogramm, auch das reicht. Aber noch gewichtiger ist das unbewußte Programm der Psyche: und das ist die Erstprägung (Graugänse Lorenz!): Was man zuerst sieht, hört, empfindet, das sitzt. Auf jeden Fall hartnäckig. Womöglich für immer. Vielleicht in alle Ewigkeit (bezogen auf rein menschliche Ewigkeiten, über die das Universum nachsichtig lächelt). Doch, obwohl ich dies weiß, packt mich beim Lesen dieses wertvollen Buches auf jeder Seite das unwiderstehliche Verlangen, mit einem Rotstift über das Geduckte herzufallen. Aber auch das nur nebenbei. Und genau dieser nun folgende Gedanke taucht aus dem Nebel der Gefühle auf, während ich lese: Wo keine feste Plattform im Meer der Ungewißheiten verankert ist, gibt es auch keinen Ort, an dem man sich festhalten könnte. Die Reformer haben es geschafft, mit ihren Willküreingriffen den Ort der Orientierung zu vernebeln, die feste Plattform zu versenken. Wie eine Fata Morgana muß die Rechtschreibung jenen jungen Leuten erscheinen, die mit der Reform aufgewachsen sind: mal hier, mal da, mal so und mal anders. Und nun: wohin geht der Mensch, wenn er kein Ziel vor sich sieht? Wonach kann er streben, wenn da nichts ist, was sich als fest und vorbildlich zeigt? Welches Ziel strebt er an, wenn er nur Irrlichter sieht? Und dies ist die größte Sünde der Politiker: daß sie dumm genug waren, jener (nach einigem Nachdenken) völlig unsinnigen Reform in den Schulen zum Sieg verholfen haben, die in Wahrheit nichts anderes repräsentierte als die Zerstörung von Sicherheiten. Die wenigsten machen sich klar: Man hat lediglich eine Herrschaft (Duden) durch eine andere (jetzt auch wieder Duden!) ersetzt. Wobei die Herrschaft der Tradition oftmals, trotz aller ihrer Widersprüche, die humanere ist –- dies kann man aus der Geschichte lernen. Die künstlichen Herrschaften mit dem Ziel, eine bessere Welt zu konstruieren, erweisen sich immer als das größere Übel. Die Reformer hatten eine Idee. Ideen zu haben ist an sich nichts Schlimmes. Wie oft hat der Mensch seltsame Einfälle! Wären immer Politiker zur Stelle, die jedem dieser kuriosen Einfälle kraft ihrer Macht zum gesellschaftlichen Leben verhelfen würden, die Menschheit hätte vermutlich ihre Existenz längst ausgehaucht. Mit der sogenannten Rechtschreibreform haben wir den heranwachsenden Generationen etwas genommen, worauf sie zuhalten konnten, was sie als Fixpunkt erkennen konnten, ob dies ihnen nun gefiel oder nicht. Heute gibt es so etwas nicht mehr. Und dies ist das wahrhaft Dramatische. Nur zynische Geister können als „Freiheit“ bezeichnen, was jetzt als Herrschaft der irrlichternden menschlichen Willkür (statt jener der Tradition, mag sie auch noch so schmerzhaft sein) auftritt. Wohin diese Art der Freiheit geführt hat, sehen wir täglich. Wohin sie uns noch führen wird, wissen wir nicht. Die langfristigen Auswirkungen dürften erfahrungsgemäß selbst jene nicht begeistern, die noch heute etwas Gutes an der anarchischen Entwicklung finden. Nichts enthebt uns der Pflicht, selbst zu denken ... |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 02.07.2008 um 22.38 Uhr |
| Die "holzverarbeitende Industrie" ist spätestens seit der Revision von 2006 wieder zulässig; die deutschsprachigen Nachrichtenagenguren bekennen sich sogar ausdrücklich zu dieser Schreibweise. Erstaunlich, daß die anscheinend nicht ganz unkundige Frau Nopper "Holz verarbeitend" weiterhin für vorgeschrieben hält. Eine denkbare Erklärung wäre, daß in ihrem beruflichen Umfeld die Hardcore-Version der Reform von 1996 weiterhin als verbindlich gilt. |
Kommentar von Glasreiniger, verfaßt am 02.07.2008 um 13.22 Uhr |
| Die Holz verarbeitende Industrie kann man noch akzeptieren, weil die holzverarbeitende Industrie sicherlich meistens damit beschäftigt ist, tatsächlich Holz zu verarbeiten. Schwieriger wäre es mit der Strom verbrauchenden oder Geld schöpfenden Industrie, gar nicht zu denken an den Menschen fressenden Tiger, der dies ja nur dann und solange ist, wie er gerade einen oder besser mehrere Menschen frißt. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 02.07.2008 um 12.37 Uhr |
| Diskutierenswert: Wird ein dekliniertes, attributiv gebrauchtes Partizip Präsens zum Adjektiv, auch wenn es zwingend ein Akkusativobjekt verlangt, was Adjektiven bisher verboten war? Beispiel: bisher "holzverarbeitende Betriebe", reformiert "Holz verarbeitende Betriebe". "Verarbeitende Betriebe" ist schlechtes Deutsch, weil "verarbeiten" immer ein Akkusativobjekt verlangt, das bisher in das Adjektiv integriert wurde, was reformiert nicht mehr erlaubt sein soll. Demnach dürften Adjektive aus Präsenspartizipien reformiert doch Akkusativobjekte besitzen, sodaß es jetzt es "transitive Adjektive" gibt. Die Grammatik wurde durch die Rechtschreibreform eben doch beschädigt, obwohl sie über der Rechtschreibung stehen soll. |
Kommentar von FAZ / Briefe an die Herausgeber, 28. Juni 2008, verfaßt am 02.07.2008 um 10.18 Uhr |
| Dann bleibt noch die Flucht ins Englische Zu danken ist Frau Jutta Limbach dafür, dass sie mit ihrem Buch "Hat Deutsch eine Zukunft?" die Diskussion und hoffentlich auch das Nachdenken über die deutsche Sprache ins Rollen gebracht hat. Auch dem Inhalt des Artikels "Sprache hat das letzte Wort" (F.A.Z. vom 29. Mai) ist zuzustimmen. Es ist wahr – insbesondere im beruflichen Alltag kommt man an Anglizismen wie zum Beispiel "Global Player", "Meeting", beziehungsweise an schon verdeutschten Anglizismen wie "downloaden" nicht mehr vorbei. Gerade Manager halten sich für besonders wortgewandt, wenn sie Anglizismen nicht nur beim Sprechen verwenden, sondern auch in deutsche Schriftsätze hineinzwingen. Aber nicht nur diese Spezies Mensch hat gelegentlich Mühe mit gängigen offiziellen Fremdwörtern, verwechselt schon mal Koryphäe mit Konifere und Soiree mit Soraya, der persischen Ex-Kaiserin. Eher selten hat der "User" für den verwendeten Anglizismus spontan den korrekten deutschen Begriff parat. Hier besteht Handlungsbedarf. Jedoch sind Anglizismen im Alltag nicht der Grund dafür, dass Deutsch als Wissenschaftssprache auf dem Rückzug ist, Englisch dagegen auf dem Vormarsch. Diese Erkenntnis ist auch nicht neu. Und leider wird Deutschlernen für Ausländer auch nach – oder gerade wegen – der Rechtschreibreform nicht einfacher. Schien bisher der bestimmte Artikel, den es im Deutschen im Dreierpack gibt und der obendrein sowohl im Singular als auch im Plural dekliniert werden muss, und das in jeweils vier Fällen, eine schier unüberwindbare Hürde (die aber mit systematischem Auswendiglernen zu nehmen ist), so ist das Auseinanderreißen zusammengesetzter Wörter fast nicht mehr zu erklären, insbesondere, wenn dadurch auch noch der Sinn verändert wird. Beispiele dafür fangen häufig mit "wohl" oder "gut" an. Und hieß es bisher "holzverarbeitende Industrie", so schreibt man jetzt "Holz verarbeitende Industrie". Die deutsche Syntax hat für Partizipformen des Präsens, denen plötzlich ein Akkusativobjekt vorangestellt wird, (noch) keine Bezeichnung. Wie lässt sich nun Ausländern, auch wenn sie hochintelligente Wissenschaftler sind, etwas vermitteln, das keinen Namen hat? Selbst der Durchschnittsdeutsche tut sich mit der Grammatik seiner Muttersprache gelegentlich schwer, es sei denn, er hat irgendwann einmal Latein gelernt. Das hilft. Aber dieser Verein leidet an Mitgliedermangel. Dass der Aspekt "Deutsch als Fremdsprache" bei der Durchsetzung der Rechtschreibreform überhaupt berücksichtigt wurde, ist eher unwahrscheinlich (wäre aber in Zeiten der Massenzuwanderung sinnvoll gewesen). Fakt ist, kein anderes Land in Europa erdreistet sich, so mit seiner Sprache umzugehen. Wir erdreisten uns sogar, das Italienische zu vergewaltigen, indem wir den Spaghetti das "h" amputieren. Warum? Jede Sprache hat ihre Besonderheiten, zum Beispiel Akzente in den romanischen Sprachen, im Französischen auch die Cedille. Im Deutschen das "ß". Machen nicht gerade auch diese Dinge eine Sprache einzigartig? Und nur in Deutschland glaubte ein Kreis Verwirrter, die Landessprache ihrer Besonderheiten berauben, ja sogar sie vergewaltigen zu müssen. Auf Kosten des Steuerzahlers, versteht sich, nicht einmal zu seinem Wohle. Der Erfolg? Mehr als fraglich – und steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Die Vergewaltigung unserer Muttersprache wird jedenfalls Deutsch als Sprache der Wissenschaft nicht wieder nach vorne bringen, vielmehr sind heute auch intelligente Menschen nicht mehr in der Lage, das Wort "Gruß" und dessen Pluralform korrekt zu schreiben. Ist das nun Nachlässigkeit oder doch eher Verwirrtheit? Am Ende vielleicht nur noch Gleichgültigkeit nach all den Debatten über diese völlig überflüssige Reform? Großes Lob an die Vergewaltiger im Rechtschreibreform-Gremium. Sie haben ganze Arbeit geleistet. Und wenn alle deutschen Stricke reißen, bleibt immer noch die Flucht ins Englische. Somit wäre auch die Frage von Frau Limbach beantwortet. Ingrid Nopper, Kenzingen |
Kommentar von Süddeutsche Zeitung, verfaßt am 28.05.2008 um 12.02 Uhr |
| Thomas Steinfeld über Limbach: „.... so groß die Verdienste der Autorin als Juristin, Richterin und als Präsidentin des Goethe-Instituts auch sein mögen, so leicht wiegt diese Schrift, mißt man sie an dem, was die Philologie über die deutsche Sprache weiß. Das Buch hat aber gar nicht den Anspruch, neue Erkenntnisse vorzutragen. Es ist von harmlos bürokratischer Gesinnung, mäßigend gegenüber dem Überschwang der Sprachreiniger und der Fundamentalisten, von milder Hoffnung beseelt ...“ „Was mit der deutschen Sprache geschieht und geschehen wird, ist zu einer Angelegenheit des Unbehagens geworden. Es ist dasselbe Unbehagen, das aus dem törichten Begehren nach einer neuen Rechtschreibung ein nationales Desaster werden ließ, dieselbe Unruhe, die Bastian Sicks Bücher und Darbietungen zum richtigen Deutsch, so oberflächlich sie sein mögen, zu gewaltigen Erfolgen macht.“ http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/258/176723/ |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 19.05.2008 um 16.50 Uhr |
| Dann sollte Herr Ickler sich womöglich vorsehen, ob nicht irgendwo Schlangen aus dem Meer gekrochen kommen. |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 19.05.2008 um 15.54 Uhr |
| Jutta Limbach: "Die Sprache gehört dem Volk." Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. (Vergil, Aeneis) Mit "volkseigen" haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht. |
Kommentar von Marco Mahlmann, verfaßt am 19.05.2008 um 09.44 Uhr |
| Vielen Dank zunächst für Ihre Gedanken zu meiner Frage; ich bin jedoch nicht überzeugt. Soweit ich weiß, werden Konsonanten nach kurzen Vokalen nur dann verdoppelt, wenn ein Vokal oder nichts folgt. In Komposita und zusammengesetzten Wörtern wird das dann der Stammschreibung wegen beibehalten. Bei "Tolpatsch" und "Tollpatsch" muß man dann also bejahen, daß es sich hier um eine Zusammensetzung aus "toll" und "patsch" handelt. Das kann man tun oder lassen. Mir geht es darum, warum "Tolpatsch" weniger deutsch aussehen soll als "Tollpatsch" und vor allem weniger als "Tölpel", "Alpen", "Tulpen" etc. pp. |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 18.05.2008 um 03.54 Uhr |
| Sorry, Herr Achenbach. Tol(l)patschig habe ich also Ihren Namen mit dem von Herrn Lachenmann zusammengezogen. Wobei ich dann aber doch gleich frage, weil ich mich das selbst frage und Sprachforschung uns ja hier zusammenführt: Wie erklärt sich das doppelte "Bach" ("Ache" und "Bach") in Ihrem Namen? (Und weil Sprache uns interessiert: Bei Opitz "lauft die Bach", was also geschlechtlich zum süddeutschen "die Ach/Ache" paßt; und durch mein Heimatdorf in Oberschlesien floß "die Baache", mit langem "a" [und das anlautende "b" ist ja dasselbe unerklärte "b", das auch aus "armherzig" unser "barmherzig" gemacht hat].) |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 18.05.2008 um 03.10 Uhr |
| Lieber Herr Achenmann, ich stimme Ihnen in allem zu. Ich hatte nur die Frage beantwortet, warum "Tollpatsch" wie ein deutsches Wort aussieht. Und Ihre Formulierung "Gegen den Strich geht mir allerdings, diese Schreibung als allein richtige vorzuschreiben. Das ist doch Eindeutschung mit der Brechstange" ziehe ich sogar meinem letzten Satz vor, — obwohl meine Formulierung da auch keinesfalls tollpatschig ist. |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 18.05.2008 um 01.47 Uhr |
| Lieber Herr Ludwig, ausnahmsweise kann ich Ihnen nicht ganz zustimmen. Die Frage von Herrn Mahlmann würde ich folgendermaßen beantworten: Die Schreibung "Tollpatsch" wirkt deshalb eher deutsch, weil sie die einzige ist, die mit den Regelmäßigkeiten der deutschen Wortbildung vereinbar ist. Danach wäre das Wort eine Zusammensetzung aus den Stammsilben "toll" und "patsch". Die herkömmliche Schreibung "Tolpatsch" ist dagegen im Deutschen nicht zu bilden. Wie sollte man es auch in seine Bestandteile zerlegen? 1. Tolp-atsch: Zwar gibt es im Deutschen die Stammsilbe "tolp" (die man aus dem Wort "Tölpel" erschließen kann); es gibt aber keine Stamm- oder Endsilbe "atsch". 2. Tol-patsch: Zwar gibt es im Deutschen eine Stammsilbe "patsch"; es gibt aber keine Stamm- oder Vorsilbe "tol". "Tolpatsch" ist eben tatsächlich ein schwieriges Wort. Es ist einerseits nicht auf Anhieb als Fremdwort zu erkennen, andererseits in diese Schreibung nicht mit den Regeln der deutschen Wortbildung zu vereinbaren. Deshalb erscheint mir die Schreibung "Tollpatsch" durchaus naheliegend, und ich vermute, daß diese (Fehl-)Schreibung auch vor der RSR häufig aufgetreten ist. Daher habe ich gar nichts dagegen, die Schreibung "Tollpatsch" "zuzulassen" (wenn es überhaupt eine Institution gäbe, die dazu befugt wäre). Ja, ich würde diese Schreibung vielleicht sogar bevorzugen. Die Tatsache, daß aus "pasch" im Deutschen "patsch" geworden ist, zeigt doch, daß das Wort bereits teilassimiliert ist. Warum nicht den nächsten Schritt gehen und das Wort ganz assimilieren? Gegen den Strich geht mir allerdings, diese Schreibung als allein richtige vorzuschreiben. Das ist doch Eindeutschung mit der Brechstange. Nun ist die Schreibung von "Tolpatsch" ja wirklich nicht wichtig. Mich stört deshalb etwas, wieviel Raum dieser Nebenfrage in diesem Forum gegeben wird. Die Leidenschaft, die sich daran entzündet, erscheint mir auch nicht recht folgerichtig. Wollen wir denn wirklich für eine etymologische Schreibung des Deutschen eintreten? Wenn ja, müßten wir dann nicht die Schreibung "Talpasch" fordern? Was könnten wir dann gegen die etymologisch korrekte Schreibung "Stängel" einwenden? |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 17.05.2008 um 22.43 Uhr |
| Zu #6742: Naja, es gibt nun mal kein deutsches Wort /atsch/, mit dem das Ende dieses Wortes in Beziehung gebracht werden könnte, und ebenso haben wir nichts mit /tolp/ im Sinn am Anfang. Dagegen ist jeder mit "toll" vertraut und seit der Kindheit mit den "Patschhändchen" und der Interjektion "(pitsch!) patsch!" wohl ebenfalls; und wer mal in der Patsche gesteckt hat, weiß auch in etwa, daß das nicht gerade der wahre Jakob ist, und mit einer Feuerpatsche versucht man einen Brand auszuschlagen, und eine Fliegenpatsche hatten wir noch zu Hause. Irgendwie "flach auf etwas aufschlagen" ist für uns bei /patsch/ schon drin. Allerdings bedeutet "toll" eher "unakzeptabel dreist" und "verrückt" (aber mit engl. "dull" ist es wohl auch verwandt; also "ungeschickt" könnte evtl. darin auch noch etwas lebendig sein); und beim Tolpatsch denken wir nicht an "flach auf etwas schlagen". Doch wenn auch die Schattenmorelle die Sonne bevorzugt, — das Volk benannte diese Kirsche nicht danach, sondern eben nach anderen Grundsätzen. Was beim von den Reformern übel hergerichteten *Tollpatsch falsch ist, ist, daß keiner aus dem Volk dazu bisher mit "toll" oder "Patsch!" angekommen ist, sondern daß man jetzt der Volksseele unbefugt eintrichtert, wie das Wort jetzt endlich verstanden werden muß, als Kompositum von hochwohlgeborenen Reformers Gnaden. |
Kommentar von Marco Mahlmann, verfaßt am 16.05.2008 um 10.16 Uhr |
| Warum sieht "Tollpatsch" wie ein deutsches Wort aus und "Tolpatsch" nicht? |
Kommentar von Germanist, verfaßt am 15.05.2008 um 21.00 Uhr |
| Serbokroatisch bedeutet "hajduk" Räuber, Wegelagerer. Laut Trunte, Kirchenslawisch, war das die osmanische Bedeutung, von der christlichen Bevölkerung wurden sie als Freiheitskämpfer gegen die Türken angesehen und unterstützt. |
Kommentar von Die Welt, 9. Mai 2008, verfaßt am 15.05.2008 um 19.52 Uhr |
| Was sagt der Name? Hajduk und Tollpatsch Von Hans Markus Thomsen Anja Hajduk, Landesvorsitzende der GAL (Grüne Alternative Liste), ist seit dem 7. Mai Hamburger Super-Senatorin in der ersten schwarz-grünen Landesregierung mit dem Ressort Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Der Name Hajduk kommt aus dem Ungarischen. Über Ursprung und Bedeutung wird bis heute gestritten. Er könnte vom ungarischen Wort haidú stammen, das Söldner bedeutet. Kommt es aber vom ähnlich klingenden Wort hajdú, dann hat es eine prekäre Doppelbedeutung: Hajdú ist der Hirte, aber auch der Räuber. Diese Doppelbedeutung gibt es in vielen Kulturen, da Hirten meistens verdächtigt werden, fremdem Vieh in ihren Herden großzügig "Gastrecht" zu gewähren. Den Namen Hajdu gibt es bei uns als Familiennamen in wechselnden Schreibungen etwa 700 Mal. Die Heiducken in Ungarn aber umfließt ein verklärender Glanz. Ursprünglich auch hier Viehtreiber, verloren sie durch die Türkenkriege im 15. Jahrhundert ihre Arbeit und bildeten Banden, die im Grenzgebiet - mal als Söldner, mal aus freien Stücken - gegen die Türken kämpften. Von der einen Seite als Terroristen verfolgt, von der anderen als Freiheitshelden gefeiert. Nach dem Ende der Türkenherrschaft bekamen sie feste Siedlungsgebiete, verdingten sich aber auch an vielen europäischen Fürstenhöfen, wo ihre malerische Kleidung der Prunksucht der Herrschaften entgegenkam. Sie haben sich auch bei uns gut reproduziert - den Familiennamen Hajduk gibt es in verschiedenen Schreibungen (am häufigsten: Heiduck) etwa 3000 Mal. Ein anderes ungarisches Wort wurde jüngst unter 3500 Einsendungen zum "schönsten Einwanderungswort" gekürt: Tollpatsch. Es ist abgeleitet vom ungarischen Wort "Talp" = Sohle. Daraus entstand ein Adjektiv "talpas", das breitfüßig bedeutet. Die ungarischen Infanteristen trugen keine Stiefel, sondern banden sich Sohlen mit Schnüren an die Füße, was sie unbeholfen wirken ließ. Zudem konnten sie sich in der mehrheitlich Deutsch sprechenden Donaumonarchie schlecht verständlich machen, und so überschnitt sich das Wort mit "Tölpel", das einen anderen Ursprung hat. Die Rechtschreibreform hat der Volksetymologie Rechnung getragen und dem korrekt Tolpatsch geschriebenen Wort ein zweites "l" verordnet. Nun sieht es mit den beiden Wortgliedern "Toll" und "Patsch" wie ein deutsches Wort aus. Es kam aber erst im 17. Jahrhundert zu uns, zu spät, um ein Familienname werden zu können. Ganz anders ist es mit dem Völkernamen der Ungarn. Denn vor den Wörtern kamen die Menschen zu uns. Heute heißen 36 000 Deutsche Hunger, Hungermann, Unger oder Ungermann. (http://www.welt.de/welt_print/article1979289/Hajduk_und_Tollpatsch.html) |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 14.05.2008 um 13.17 Uhr |
| Ich wußte noch gar nicht, daß Verona Pooth jetzt unter einem Pseudonym als "Blogger" für die "Welt" schreibt. Man lernt doch nie aus! |
Kommentar von Thomas Paulwitz, verfaßt am 13.05.2008 um 16.05 Uhr |
| Von der Pressekonferenz zum Grimme-Online-Award berichtet der Welt-"Blogger" Daniel Fiene: "Herr Spiegel von der FAZ scherzte, dass schon sämtliche Wortwitze zu seinem Namen und Arbeitgeber gemacht worden sind und die Messlatte für eine neue Variante enorm hoch ist, aber nicht weniger süffisant berichtete er von den anhaltenden Leserprotest, den FAZ Reading Room doch mit einem deutschen, eingängigeren Titel zu versehen. Herr Spiegel ist eigentlich kein Zahlenmensch, hat aber doch festegestllt, dass es einen großen Zuspruch an den Leseraum der FAZ gibt. Deswegen sei die Umbennung in ebendiesen Leseraum auch gerne gemacht worden." |
Kommentar von Thomas Paulwitz, verfaßt am 08.05.2008 um 18.50 Uhr |
| Immerhin winkt nun der Grimme Onnlein Ouoad. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 08.05.2008 um 10.15 Uhr |
| Wirklich? Dabei hatte man sich zuvor mit dem neuesten Naziporno doch bereits einen so schönen Diskussionsgegenstand gewählt. |
Kommentar von Thomas Paulwitz, verfaßt am 08.05.2008 um 08.02 Uhr |
| Es handelt sich natürlich auch um eine große Werbeaktion für das FAZ-Bücherforum. Bevor das Limbach-Buch eingestellt wurde, war die Leserbeteiligung ziemlich gering. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 08.05.2008 um 06.25 Uhr |
| "Lesesaal" – darauf muß man erst einmal kommen! Die Herausgeber haben es allein nicht geschafft, es war eine große Wortfindungsaktion nötig: Wie nennt man einen (virtuellen) Raum, in dem viele Menschen zugleich sich dem Lesen hingeben … Die Eiertänze mit überflüssigen Begründungen usw. machen in meinen Augen die Herausgeber der FAZ nicht vertrauenswürdiger, und ich bin immer noch weit davon entfernt, mein nach 40 Jahren abgebrochenes Abonnement wiederaufzunemen. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 08.05.2008 um 01.42 Uhr |
| Nein, im Prinzip sind beide Versionen zugelassen, aber die Zusammenschreibung hat sich im Bundesdeutschen nicht so recht etabliert. Im übrigen würde ich mal annehmen, daß es bei der Fatz noch ein paar Leutchen gibt, die wissen, wie man erratisch schreibt. Dazu muß man nicht unbedingt hier nachlesen. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 07.05.2008 um 19.59 Uhr |
| Lieber Herr Markner, offensichtlich liest Ebbinghaus hier mit, denn nun ist es "erratisch" geworden. Bislang sieht ein Leser übrigens diese Umbenennung als ersten Schritt, dem nun die herkömmliche Orthographie als zweiter folgen müßte. Allerdings erscheint sein Beitrag durch das hauseigene ZER-Programm arg verunstaltet. Schließlich ist mir noch Ebbinghaus' "sodass" aufgefallen, das ich bislang immer für eine österreichische Spezialität gehalten habe, bis es dann erstmals 1998 zementiert wurde. Ist diese Zusammenschreibung nicht inzwischen wieder revidiert worden? |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 07.05.2008 um 19.11 Uhr |
| Womit dann auch meine schwarze Mutmaßung widerlegt ist. "Zum Glück", wollte ich noch hinzufügen und stutze. Auffallend ist doch, daß die F.A.Z. (ich vergesse stets die Punkte, welche die FDP früher auch mal besaß) sich bei der Benennung ihres virtuellen Rezensionsforums demokratisch gebärdet, bei ihrer Gleichschaltung zum 1. Januar 2007 aber nicht den Mut fand, sich einer Leserumfrage zu stellen. Sollte hier womöglich die Korrektur des kleineren Übels vom größeren ablenken? |
Kommentar von Wolfram Metz, verfaßt am 07.05.2008 um 17.55 Uhr |
| Wenigstens die Rechtschreibung soll aber noch ein bißchen ans Englische erinnern: »F.A.Z. Lesesaal«. |
Kommentar von R. M., verfaßt am 07.05.2008 um 17.38 Uhr |
| Für den Leseroom hat's nicht gereicht. Zu „eratisch“ waren, so Uwe Ebbinghaus, auch andere Vorschläge wie die Lit.Faz.Säule. Deshalb soll der vormalige Reading Room der Fatz nun doch Lesesaal heißen. http://readingroom.faz.net/limbach/article.php?txtid=umbenennung |
Kommentar von Christoph Schatte, verfaßt am 04.05.2008 um 22.07 Uhr |
| Theodor Ickler sieht folgendes deutlich: "Von unseren lieben Deutschen erwartet man eigentlich Leseroom (wie Backshop usw.). [...]" Um das Kind beim Namen zu nennen (und evtl. entsprechende Magisterarbeitsthemen anzugehen): Das fremde Grundwort des Determinativkompositums wird als Träger eines meist nur scheinbar neuen Begriffs wie "room" mit indigenen, d.h. vertrauten Elementen "näher bestimmt" usw., um so dem meist nur erahnten Bezug des fremden Lexems per Bestimmungswort ein Minimum an Operationalität (sprich: minimaler "Verstehbarkeit") einzuhauchen und es so minimal "heimisch" zu machen. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 04.05.2008 um 16.38 Uhr |
| Wenn ich mir die Beiträge zum Thema der Namensfindung so ansehe, dann überwiegen eindeutig die Gegner des "Reading Room". Trotzdem wird Schirrmacher wohl dabei bleiben. Erstens wäre sonst sein Ego zu sehr angekratzt und zweitens hatte diese Diskussion doch fast schon mehr Erfolg als die Vorabkapitel des Buches von Jutta Limbach. Zu keinem anderen Thema haben sich mehr Menschen zu Wort gemeldet. Ein paar Tage lang war wirklich so etwas wie Leben in seinem Forum. Es bleibt die Frage, ob sich das wiederholen läßt, oder ob der Reading Room nun wieder vor sich hindämmern wird. Nicht mehr diskret beleuchtet von vielen grünbeschirmten Messinglampen, sondern nurmehr von einer einsamen Funzel in der Hand des Darmol-Männchens. Trotzdem war diese Diskussion für mich sehr lehrreich. Gleichen sich doch die Art der Argumentation und z. T. auch die Argumente selbst bei diesem Thema und der Rechtschreibreform: Wir können nicht mehr zurück, weil wir sonst den Anschluß verlieren! Wer auf deutsch beharrt, ist ewiggestrig! Sich der (wohlgemerkt englischsprachigen) Globalisierung widersetzen, heißt sich den segenbringenden Synergieeffekten (das Wort fiel wohlgemerkt nicht direkt, stand aber immer zwischen den Zeilen!) dieser Internationalisierung zu widersetzen! Und natürlich findet sich die Mehrzahl der sogenannten Autoritäten auf der Seite der Befürworter. Wenn man nur die Staatsmacht (oder deren Derivat) hinter sich wähnt! So gesehen, lieber Herr Paulwitz, fürchte ich hier doch nur eine Posse zu sehen. Ich bleibe zwar am Hofe der Hoffnung, fürchte aber dennoch die Danaer, auch wenn sie das Geschenk des Volksentscheids bringen. Und übrigens, wurde Troia nicht schon einmal in den Norden der Republik verlegt? Natürlich liegt Kiel viel näher an der Küste als Frankfurt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die Seeschlangen auch diese Entfernung problemlos meisterten. Uns bleibt freilich die Hoffnung, auf ewig marmorn im Belvedere zu stehen und von japanischen Touristen photographiert zu werden. "Exegi monumentum aere perennius." Dann wird nämlich niemand mehr von Schirrmacher und seinem Reading Room sprechen. |
Kommentar von Thomas Paulwitz, verfaßt am 02.05.2008 um 14.44 Uhr |
| Immerhin werden seit heute die Leser dazu aufgefordert, bis Sonntag Gegenvorschläge zu "Reading Room" zu machen. Wenn die Veranstaltung nicht zur Posse ausarten soll, dann müßte die Umbenennung am Ende stehen. Obwohl, in einem einzigen Fall könnte ich die Beibehaltung des Namens RR akzeptieren. Wenn die F.A.Z. auf die vernünftige Rechtschreibung umstellte statt den RR umzubenennen, sähe ich über die Namensgebung tatsächlich hinweg. |
Kommentar von Oliver Höher, verfaßt am 02.05.2008 um 12.38 Uhr |
| Vielen Dank, lieber Herr Paulwitz. Daß am sogenannten Reading Room noch "stark gebastelt" wird, ist mir auch schon aufgefallen. Die vielen Reaktionen gerade auf diese Namenswahl zeigen jedoch, daß sie zumindest negativ aufstößt. Die auf's Maul schauenden Tischreden Luthers wirken also doch noch nach! Schirrmacher freilich wird das ignorieren. Denn wer die Weisheit (Weißheit paßt hier fast noch besser, da er sich ja geradezu gebärdet wie die Unschuld vom Lande) mit Löffeln gefressen hat, steht einfach haushoch über jeder Kritik. Schillers Theorie des Erhabenen ist ähnlich gestrickt, auch wenn die Schuhe jetzt wieder deutlich zu groß sind. Bislang sehe ich es so, daß hier der geradezu verzweifelte Versuch unternommen wird, das neugestaltete Forum der FAZ mit so etwas wie Leben zu füllen. Bücher über die deutsche Sprache eignen sich dazu momentan eben sehr gut. Nun war leider kein neues Werk von Sick verfügbar und womöglich ist Limbach für die FAZ – eingedenk des inzwischen arg verblaßten Ruhmes vergangener Zeiten – auch noch der elitärere Name. Die vielen lustigen Photos vom Sauerkraut in Japan und ähnlichem geben zudem der Redaktion endlich Gelegenheit, die digital gespeicherten Urlaubserinnerungen der letzten Jahre würdig zu präsentieren. Mit Limbachs Buch haben sie ja wohl nichts zu tun, da die Verlagsankündigung nichts von Abbildungen erwähnt. Und warum sollte ich kennzeichnen, daß meine Beiträge ohne orthographisches Verfallsdatum erscheinen (Dank an Herrn Weiers für diese Begriffsprägung)? Sind das die Umstände, die dort eine sachliche Diskussion begleiten? Nein, vielen Dank. Ich bleibe in diesem Fall nur Leser. Soll Herr Schirrmacher doch mit seinem Forum glücklich werden. Und wenn es schon auf englisch sein soll: warum nennt er es nicht Lord Chamberlain's Office? Das erinnert – das war ja beabsichtigt – ebenfalls an eine kulturelle englische Einrichtung, die es inzwischen nicht mehr gibt. Gelegentlich hat in diesem Forum hier auch Julian von Heyl mitdiskutiert. Die Redaktion sollte dort überall noch schnell nachtragen, daß alle seine Beiträge auf speziellen Wunsch des Verfassers in Reformschrieb erscheinen. |
Kommentar von Thomas Paulwitz, verfaßt am 30.04.2008 um 20.51 Uhr |
| Lieber Herr Eversberg, mit dem Hinzufügen der Bannformel "Auf Wunsch des Verfassers erscheint dieser Beitrag in traditioneller Rechtschreibung" sollte es klappen. AM RR wird übrigens noch stark gebastelt. |
Kommentar von Roger Herter, verfaßt am 30.04.2008 um 19.52 Uhr |
| Die lieben Deutschen können allerdings (gelegentlich) auch anders. Was Backstuben und dergleichen betrifft, hatte ich mir einst ein paar Müsterchen notiert, darunter das Kabinettstückchen BreadSell... Und bis vor kurzem war neben einer hiesigen Bäckerei noch in großen weißen Lettern zu lesen: Bhagwan, frische Bhagwan! |
Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 30.04.2008 um 19.46 Uhr |
| Heute hatte ich aus gegebenem Grund diesen Satz hingeschickt: "Was ich nicht verstehe und nicht akzeptiere, das ist, daß man den Teilnehmern ungefragt ein ss für ein ß unterschiebt. Vermutlich sollen die hier mitlesenden Erstkläßler nicht verwirrt werden, aber unter solchen Vorzeichen bin ich nicht geneigt, hier noch mehr Zeit zu verbringen." Den haben sie (oder läuft das nur durch eine Korrektursoftware – man weiß es nicht) durchgelassen, nur aus dem "daß" wurde "dass" gemacht, Erstkläßler aber belassen. Seufz. |
Kommentar von Horst Ludwig, verfaßt am 30.04.2008 um 18.14 Uhr |
| Liebe Leseroommates, so lehre ich's hier: Wenn im Deutschen ein Substantiv von einem vorausgehenden Substantiv modifiziert wird, schreibt man beide zusammen. Der geringste Grad der Zusammenschreibung ist die mit Bindestrich. Fürs Englische hier versichere man sich am besten in einem zuverlässigen Wörterbuch. (Im amerikanischen Englisch sieht man's viel öfter auseinander; aber auch im britischen Englisch, wie gesagt: Wörterbuch, — so daß man ruhig schlafen kann.) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 30.04.2008 um 17.54 Uhr |
| Von unseren lieben Deutschen erwartet man eigentlich "Leseroom" (wie "Backshop" usw.). Vielleicht könnte man das Herrn Schirrmacher mal vorschlagen. |
Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 30.04.2008 um 14.25 Uhr |
| Na gut, dann sei's drum, ich hatte nur in zwei Langenscheids und in einem Oxford Dictionary of Current English nachgesehen. Alle drei schreiben es nur mit Bindestrich. Aber Hornby zählt natürlich mehr, wieder was gelernt. |
Kommentar von David Konietzko, verfaßt am 30.04.2008 um 14.16 Uhr |
| Laut A.S. Hornbys ›Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English‹ (6. Auflage, 2000) schreibt man reading room (ebenso living room und sitting room). Im Englischen werden Zusammensetzungen bekanntlich oft getrennt geschrieben. |
Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 30.04.2008 um 14.00 Uhr |
| Momentan diskutieren sie die Frage, ob denn der Reading Room so heißen dürfe. Ich bin dafür. Noch 'ne Blamage kann der Zeitung nur gut tun. Es schaut ja offenbar keiner in ein Wörterbuch, auch die Diskutanten nicht. Denn die korrekte Schreibweise ist "reading-room", alldieweil es ohne Bindestrich ja "lesender Raum" bedeuten würde. Trotzdem wird diese Scheindebatte zu nichts führen. |
Kommentar von Fatznet, verfaßt am 28.04.2008 um 09.48 Uhr |
| Haben wir eine Sprache mit Zukunft? 24. April 2008 Wohl noch nie ist in deutschsprachigen Ländern ein so gutes Deutsch von einer so großen Zahl von Menschen gesprochen und geschrieben worden. Diese Behauptung wird Protest auslösen. Ist doch die deutsche Sprache ein beliebter Gegenstand moralisierender Nörgelei. Es ist ein deutscher Aberglaube, zu meinen, dass man einem geschätzten Kulturgut am besten dient, wenn man seinen Zustand bejammert und seinen Verfall prophezeit. Je drastischer das Bedrohungsszenarium an die Wand gemalt wird, desto mehr geraten die Vorzüge der deutschen Sprache in den Hintergrund. Wer Texte sucht, die Kauderwelsch aufbieten, wird stets reiche Beute finden. Dennoch wird die deutsche Sprache nicht wegen der Seitensprünge in fremde Reviere und wegen der dabei erzeugten Mischlinge dahinwelken. Besser als jede deutschtümelnde Beckmesserei bewahrt gute Literatur die poetische und sprachschöpferische Kraft unserer Sprache. Literaturpreis-Jurys haben weniger ein Qualitäts- als ein Mengenproblem zu meistern. Gleichwohl sei die populäre Sprachkritik nicht geringgeschätzt, beweist sie doch Sensibilität für Fragen der Sprachästhetik. Dieses aus der Gesellschaft kommende Schutzbedürfnis bestätigt die These, dass die Sprache eine Res publica, eine öffentliche Angelegenheit im ursprünglichen Sinne, ist. Nicht eine Akademie schreibt vor, wie das Deutsche richtig gesprochen und geschrieben wird. Die Sprachgemeinschaft ist es, die unsere Muttersprache fortbildet. Das meint auch der Bundestag, der im Streit um die Rechtschreibreform dem Bundesverfassungsgericht mitteilte, dass "sich die Sprache im Gebrauch der Bürgerinnen und Bürger ... ständig und behutsam, organisch und schließlich durch gemeinsame Übereinkunft weiterentwickelt. Mit einem Wort: Die Sprache gehört dem Volk." In der Tat: Die Muttersprache ist eine Privat- und öffentliche Angelegenheit freier Bürger. Nicht die Frage, ob Rohheit mit einem oder zwei "h" geschrieben werden sollte, macht die deutsche Sprache gegenwärtig zu einem Politikum. Zwei Phänomene sind es, die die Sprachpolitik herausfordern: die Globalisierung und die Migration. Der mit der Wirtschaft einhergehende Trend zum Englischen als einziger Weltsprache bedroht nicht nur den Status des Deutschen als Europasprache. Auf längere Sicht können die kulturelle Unterschiede einebnenden Kräfte zu einem Verkümmern der anderen Sprachen führen. Der Glaube, die deutsche Sprache werde sich als Kultursprache, als die Sprache der Dichter und Denker behaupten, dürfte sich mit der Zeit als treuherzig erweisen. Denn eine Sprache, die in der Arbeitswelt immer weniger gesprochen wird, verarmt und taugt eines Tages nur noch als Schlüssel zum Sich-Erinnern an die Blütezeit deutscher Hochkultur. Mangels eines fortgebildeten Wortschatzes lässt sie uns sprachlos bei der Reflexion von Gegenwartsproblemen und dem Entwurf von Zukunftsplänen in der entgrenzten Welt. Sprache als Friedensstifter Die Sorge, dass auch von der Europäischen Union ein Druck auf eine internationale Verkehrssprache ausgehen könnte, scheint auf den ersten Blick unbegründet. Denn der Reformvertrag von Lissabon setzt diesem Trend die Maxime der Mehrsprachigkeit entgegen. Die Vielzahl der Sprachen gehört seit jeher zu den kulturellen Schätzen Europas. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu respektieren und das kulturelle Erbe zu bewahren. Im Sinne dieser Aufgabe hat die Europäische Kommission das Jahr 2008 dem interkulturellen Dialog gewidmet. Eingedenk der Tatsache, dass sprachliche und kulturelle Vielfalt zugleich Quelle von Reichtum, aber auch von Spannungen ist, gilt es, die positiven Auswirkungen der Vielsprachigkeit Europas zu stärken. Auf den ersten Blick berechtigen die offiziellen Sprachregeln der Europäischen Union zu großen Erwartungen. Seit ihrer Gründung sind alle offiziellen Sprachen der Mitgliedstaaten gleichberechtigt. Zudem ist die deutsche Sprache seit 1993 neben der englischen und französischen zur dritten internen Arbeitssprache in der Kommission gewählt worden. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Unsere Landsleute in Brüssel haben aus diesem privilegierten Status kaum Kapital zu schlagen vermocht. Die Tatsache, dass laut dem Eurobarometer rund 83 Millionen Menschen in der Europäischen Union Deutsch als Muttersprache und seit der Ost-Erweiterung rund 63 Millionen als Fremdsprache sprechen, hat sie im Gebrauch der deutschen Sprache kaum zu stimulieren vermocht. In sieben Ländern hat Deutsch einen offiziellen Status. Der deutsche Sprachraum mit seinen vierzehn Sprachnachbarn ist ein Transit- und Austauschgebiet par excellence zwischen Nord und Süd und seit dem Fall des Eisernen Vorhangs auch zwischen Ost und West. Gäbe es nicht die Lichtblicke einer in Brüssel deutsch sprechenden Kanzlerin und den Protest des Bundestags wegen der fehlenden Übersetzung Brüsseler Texte in die deutsche Sprache, man könnte schier verzweifeln über die deutsche Sprachflucht in der Union. Wir können nur hoffen, dass der Deutsche Bundestag und das Auswärtige Amt nicht zu spät erwacht sind, um die Versäumnisse künftig wettzumachen. Eine kluge Personal- und Sprachpolitik sind gefordert. Diese darf allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass auch die anderen Europäer ihre Sprache lieben und sie nicht verkümmern lassen wollen. Das Bildungsziel der Mehrsprachigkeit ist ein normatives Konzept und kein Sprachregime. Sprachgewirr an Berliner Schulen Wer Anschauungsunterricht in Sachen kultureller und sprachlicher Vielfalt sucht, braucht nicht auf Reisen in fremde Länder zu gehen. In vielen deutschen Städten zeigen bereits die Geschäftsbezeichnungen der Gaststätten, Kioske und Feinkostläden eine Vielfalt von Sprachen und Kulturen an. Auch wenn einige Politiker noch immer Schwierigkeiten haben, das Wort "Einwanderungsland" in den Mund zu nehmen, müssen sie sich der Tatsache stellen, dass hierzulande fast sieben Millionen Ausländer, darunter rund drei Millionen Muslime, leben, die Deutschland als zweite Heimat betrachten. Die zugewanderten Menschen sprechen in vielen Zungen. Ein Beispiel bietet das babylonische Sprachengewirr auf Berliner Schulhöfen, dem wir mit "Deutschpflicht" und "Pausensprache" zwei jüngst neu zusammengesetzte Wörter verdanken. In siebzig Berliner Oberschulen ist Deutsch für die große Mehrzahl der Schüler nicht die Muttersprache. Mitunter werden an diesen Schulen acht bis zehn verschiedene Herkunftssprachen gesprochen. Gewalt gehört an diesen Berliner Schulen zum Alltag. Deutsche sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Es geht nicht um ein Problem von In- und Ausländern, sondern um die Herkunft aus den ärmsten Schichten. Die Pisa-Studien haben auf eindringliche Weise deutlich gemacht, dass die Lebenschancen der Migrantenkinder in hohem Maße durch mangelnde Lernhilfen vertan werden. Wir wissen, dass das Gleiche auch für deutschsprachige Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern gilt. Die aus kultureller Zwietracht resultierenden Gewaltausbrüche haben die Politik herausgefordert, sich erneut und grundsätzlicher der Integration von Zuwanderern anzunehmen. Eigene Integrations- und insbesondere Sprachkurse sollen den Zuwanderern helfen, sich in der deutschen Kultur und Politik zurechtzufinden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein notwendiges, wenn auch kein ausreichendes Mittel der Integration. Eine aktive Bürgerschaft ist ohne die Fähigkeit, sich sprachlich zu verständigen, kaum möglich. Nicht nur der Druck und die Pflicht, Deutsch zu lernen, auch das Erlernen der Mutter- und Herkunftssprache werden im heißen Streit erörtert. Viele Kinder aus Zuwandererfamilien beherrschen weder die Landes- noch ihre Muttersprache. Gibt es - wie es in dem Berliner Schulstreit behauptet worden ist - ein Grundrecht auf Muttersprache? Ist der deutsche Staat verpflichtet, Kindern aus Einwandererfamilien das Erlernen ihrer Herkunftssprache zu ermöglichen? Gibt es wenigstens eine Art Minderheitenrecht, das den Staat verpflichtet, Kultur und Sprache der zugewanderten Volksgruppen zu schützen und zu fördern? Weder das Grundgesetz noch andere deutsche Rechtsquellen geben eine positive Antwort auf diese Frage. Diese Rechtslage schließt es aber nicht aus, die zugewanderten Minderheiten bei dem Versuch zu unterstützen, ihr kulturelles Erbe und ihre Sprache zu pflegen. Für alle gilt die Humboldtsche Einsicht, dass die Muttersprache der Königsweg zur Bildung der Persönlichkeit ist. Der mit dem Spracherwerb verbundene geistige Prozess bringt Selbstbewusstsein und ein kulturelles Wertesystem hervor. In der Bundesrepublik sollte die Bereitschaft reifen, die Tatsache, dass Migrantenkinder sich in zwei Sprachwelten zurechtfinden müssen, nicht nur als Defizit, sondern als Schatz zu betrachten. (Link) |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 26.04.2008 um 16.35 Uhr |
| "Tollpatsch" ist also das beste zugewanderte Wort! Allerdings ist es nicht aus Ungarn ins Deutsche eingewandert, sondern aus Siegen. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 26.04.2008 um 15.40 Uhr |
| "Einerseits ist die Muttersprache private, andererseits öffentliche Angelegenheit." (Klaus Achenbach) Frau Limbach wird hier an die (ziemlich altmodische) Unterscheidung von citoyen und bourgeois gedacht haben, der die (ebenso altmodische) Unterscheidung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft entspricht, die wiederum mit der Unterscheidung zwischen res publica und bürgerlicher Öffentlichkeit korrespondiert. Allerdings bleibt "privat" auch dann der Gegenbegriff zu "öffentlich", wenn diese Unterscheidungen entfallen. Die Adjunktion "privat + öffentlich" tritt bei Limbach in die Rolle von "bürgerliche Gesellschaft" als Gegenbegriff zu "Staat" ein und erlaubt zugleich, diesen Begriff (Staat) nicht einzuführen. Die explizite Aussage, in Deutschland bilde nicht der Staat, sondern die bürgerliche Gesellschaft die Schriftsprache fort, ist der Verfassungsjuristin wohl doch etwas zu abstrus gewesen. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 26.04.2008 um 14.44 Uhr |
| Herr Lachenmann bringt es auf den Punkt. Eine für jedermann erkennbar delirierende Äußerung – in Deutschland werde die Schriftsprache von der Gemeinschaft freier Bürger fortgebildet, behelligt nicht einmal von einer Akademie – kann nicht nur mit Duldung rechnen (dann wäre sie in Limbachs Text bloß funktionslos), sondern mit Zustimmung: als Ausweis von common sense, von Ausgewogenheit und Besonnenheit. Darin liegt aber das Problem, nicht schon die Lösung. |
Kommentar von Rominte van Thiel, verfaßt am 26.04.2008 um 12.13 Uhr |
| In besagtem "Reading Room" kann man heute lesen, daß "Tollpatsch" beim Wettbewerb, bei dem es um das beste eingewanderte Wort ging, als einer der Gewinner ermittelt wurde. Es bedarf schon einiger Verrenkungen, um unter den Tisch fallen zu lassen, daß dieser arme Tropf keineswegs herumtollend als Spaßmacher nach Deutschland gewandert oder besser gehüpft und gekugelt kam. |
Kommentar von Walter Lachenmann, verfaßt am 26.04.2008 um 10.37 Uhr |
| Das Risiko, die hier verteilten Backpfeifen sich einzuhandeln, ist für Frau Limbach gleich null, denn die dringen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bis zu ihren Wangen. Es werden sie im Gegenteil, sofern überhaupt jemand auf ihren doch ziemlich langweiligen und belanglosen Besinnungsaufsatz reagiert, lauter Lobesworte erreichen über die vorzügliche Ausgewogenheit und Besonnenheit ihrer Ausführungen. Frau Limbach persönlich zu kritisieren läuft wohl überhaupt ins Leere, nicht allein, weil diese Kritik nie bei ihr ankommen wird, sondern auch weil sie sie vermutlich gar nicht begreifen würde. Die Diskussion, sofern sie überhaupt noch kontrovers stattfindet, ist doch deshalb so hoffnungs- und aussichtslos, weil – besonders in der Öffentlichkeit – zu viele Leute sich daran beteiligen, die gar nicht wissen, wovon sie reden und worauf es ankommen würde. Das gilt leider immer wieder auch von solchen, die die Reform kritisieren und dann oft die am einfachsten zu entkräftenden und zu widerlegenden oder auch sachfremde Argumente bringen (z. B. neulich wieder Wolf Schneider, der nicht mitbekommen hatte, daß Einzelvokale jetzt doch nicht mehr abgetrennt werden sollen und sich über die Trennung "Popi-kone" lustig machte). Der Trend geht wohl dahin, die Reform jetzt mehr oder weniger kompetent als verfehlt oder gar als Quatsch zu bezeichnen, ihr aber dennoch so unqualifiziert es eben geht (qualifiziert geht es ja gar nicht) zu folgen. Dieser Zustand wird wohl noch einige Zeit so bleiben, bis er als nicht mehr länger hinnehmbar empfunden wird. Was dann passiert, weiß niemand, ob es eine bessere Rechtschreibung geben wird oder eine noch schlechtere, weil der unbefriedigende Zustand der jetzigen auf eine zu "halbherzige" und durch den Rechtschreibrat überdies noch verwässerte Reform zurückgeführt wird, und aufgrund welcher Autorität (Sprachwissenschaft oder Politik), weiß man auch nicht. |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 26.04.2008 um 02.05 Uhr |
| Was Herr Achenbach, Herr Eversberg, Herr Ickler (und auch ich) jetzt an Abfälligkeiten über Frau Limbach geäußert haben, ist gewiß begründet und berechtigt. Meine Frage lautet jedoch, warum die Dame überhaupt riskiert, sich solche Backpfeifen einzuhandeln. (Sie hätten um noch einiges kräftiger ausfallen können. Schließlich insinuiert Jutta Limbach ja auch die Verwurzelung der Reformgegner in einer "populären Sprachkritik", deren Verachtung sie gerade mit der Formulierung kundtut, diese Kritik sei "gleichwohl" nicht geringzuschätzen.) Auffällig ist Limbachs Drang, eine offenkundig fiktionalisierte Realität in die Darlegung einer Agenda hineinzutragen, die zu ihrer Encadrierung der betreffenden Fiktion gar nicht bedarf. Es sei denn, die Agenda dient nur dazu, die Fiktion zu stützen. Was wiederum nicht anzunehmen ist. |
Kommentar von Theodor Ickler, verfaßt am 25.04.2008 um 16.51 Uhr |
| Wie Herr Achenbach schon gesagt hat, ist sich Frau Limbach nicht zu schade, uns den uralten Trick der Reformer aufzutischen und damit über den Milliardenschaden und die enorme Verunsicherung hinwegzuhudeln, die die Reformer angerichtet haben. Nicht diese, sondern die Kritiker werden der Lächerlichkeit preisgegeben, weil sie sich angeblich über das zusätzliche h in "Rohheit" aufregen. Das ist schäbig, paßt aber ins Bild, wenn man das bisherige Wirken des Sprachrates betrachtet und dazu die seltsamen Vorgänge am Goethe-Institut (die unterdrückte Resolution und der Übereifer beim Durchsetzen der Reform). Ich habe leider nicht den ganzen Wilhelm von Humboldt im Kopf, aber hat er wirklich gesagt, das Erlernen der Muttersprache sei der Königsweg zur Bildung? Mir schwebt immer vor, daß man Latein und vor allem Griechisch lernen sollte. Da muß ich noch mal nachschlagen, sonst habe ich die ganze Zeit etwas Falsches gelernt. |
Kommentar von b.eversberg, verfaßt am 25.04.2008 um 08.47 Uhr |
| Für Frau Limbach und für das Lesesaal-Gremium der FAZ gehört die Verschriftung offenbar nicht wirklich zum Thema "Deutsch", sondern sie ist eine ganz niedrige, wohl als eher unappetitlich empfundene Kategorie, die nicht (mehr) beachtet, geschweige diskutiert wird. Was immer da geschehen ist und was für Mißstände da bestehen mögen, es ist unwichtig, es ist dumm gelaufen, ja, aber gelaufen. Deshalb kann der Rat so untätig sein wie er will – niemand erwartet was von ihm, niemand sieht noch Handlungsbedarf, niemand wird darüber berichten – "no pasa nada". |
Kommentar von Klaus Achenbach, verfaßt am 25.04.2008 um 01.35 Uhr |
| Es stimmt schon sehr skeptisch, daß Frau Limbach hier einen billigen rhetorischen Trick – nämlich eine Nebensache (Roheit – Rohheit) als Hauptsache darzustellen – benutzt, um die Frage der RSR zu verniedlichen. Immerhin hat sie hat ja vollkommen recht, daß „nicht eine Akademie vorschreibt, wie das Deutsche richtig gesprochen und geschrieben wird“. Nein, es ist die KMK, die das tut. Hätten wir eine dafür zuständige Akademie der Dichter und Denker, wäre es jedenfalls nicht zu dieser RSR gekommen. „Die Sprache gehört dem Volk“ So hat es der Bundestag dem Verfassungsgericht mitgeteilt. Meint Frau Limbach, daß das Gericht unter ihrem Vorsitz daraus die richtigen Schlußfolgerungen gezogen hat? Ich hoffe sehr, daß sie in ihrem Buch dazu etwas Nachdenkliches zu sagen hat. Ansonsten sind ihre „wichtigsten Thesen“ eine Folge von dezidierten Einerseits-Andererseits, die etwas an den „Besinnungsaufsatz“ unseligen Angedenkens erinnern. Einerseits soll man „moralisierende Nörgelei“, „deutschen Aberglauben“, Verfallsprophezeiungen und „Bedrohungsszenarien“ vermeiden, andererseits sollte man aber „populäre Sprachkritik“ nicht „geringschätzen“. Einerseits ist die Muttersprache private, andererseits öffentliche Angelegenheit. Was meint Frau Limbach eigentlich mit „populär“ – beliebt, volkstümlich, nichtprofessionell? Was ist denn eigentlich „eine öffentliche Angelegenheit im ursprünglichen Sinne“? Weiterhin andererseits muß man zwar nicht einen Verfall, dafür aber ein „Verkümmern“ des Deutschen befürchten; wäre es „treuherzig“ zu glauben, „die deutsche Sprache werde sich als Kultursprache, als die Sprache der Dichter und Denker behaupten“. Was die Stellung des Deutschen in der EU anbetrifft, kann man einerseits nur hoffen, „dass der Deutsche Bundestag und das Auswärtige Amt nicht zu spät erwacht sind, um die Versäumnisse künftig wettzumachen“. Andererseits darf man aber „nicht aus den Augen verlieren, dass auch die anderen Europäer ihre Sprache lieben und sie nicht verkümmern lassen wollen“. Man darf wohl annehmen, daß Frau Limbach schon viel früher aufgewacht ist und in ihrem Buch dem Bundestag und dem Auswärtigen Amt viele nützliche Ratschläge geben kann, wie man „eine kluge Personal- und Sprachpolitik“ betreibt. Was die Gewalt an Berliner Schulen mit dem Thema des Buches zu tun hat, ist nicht ganz klar. Einerseits geht es „nicht um ein Problem von In- und Ausländern“, andererseits resultieren die „Gewaltausbrüche“ aus „kultureller Zwietracht“. Einerseits ist „das Erlernen der deutschen Sprache ein notwendiges, wenn auch kein ausreichendes Mittel der Integration“, andererseits ist „die Muttersprache der Königsweg zur Bildung der Persönlichkeit“. Die deutsche Rechtslage ergibt einerseits kein „Grundrecht auf Muttersprache“, schließt diese andererseits aber auch nicht aus. Einerseits beherrschen „viele Kinder aus Zuwandererfamilien weder die Landes- noch ihre Muttersprache“, andererseits sollte „in der Bundesrepublik die Bereitschaft reifen, die Tatsache, dass Migrantenkinder sich in zwei Sprachwelten zurechtfinden müssen, nicht nur als Defizit, sondern als Schatz zu betrachten“. Ob man für das Buch wirklich EUR 14,90 ausgeben sollte? |
Kommentar von Urs Bärlein, verfaßt am 24.04.2008 um 23.07 Uhr |
| "Nicht eine Akademie schreibt vor, wie das Deutsche richtig gesprochen und geschrieben wird. Die Sprachgemeinschaft ist es, die unsere Muttersprache fortbildet. ... Die Muttersprache ist eine Privat- und öffentliche Angelegenheit freier Bürger." Sind das nun Tatsachenbehauptungen oder Aussagen darüber, wie es sein sollte? Im ersten Fall deliriert Frau Limbach, im zweiten wundert man sich, daß die Reform gar nicht ihr Thema ist, wie aus dem Beginn des nächsten Absatzes hervorgeht: "Nicht die Frage, ob Rohheit mit einem oder zwei 'h' geschrieben werden sollte, macht die deutsche Sprache gegenwärtig zu einem Politikum." Also war die Frage einmal ein Politikum? Und wenn ja, wie kam es, daß sie heute kein Politikum mehr ist? Weil die freien Bürger der Sprachgemeinschaft die Schreibung "Roheit" zu "Rohheit" fortgebildet haben? Oder nicht doch, weil die Frage politisch entschieden wurde? – Die Ereignisse liegen noch nicht lang genug zurück und spielten sich zum Teil auch in zu naher Umgebung der heutigen Deutschliebhaberin ab, als daß sie ihr hätten verborgen bleiben können. An Dummheit oder Unwissenheit kann es nicht liegen. Trotzdem bleibt auch Schamlosigkeit, als die dann nächstliegende Erklärung, unbefriedigend. Gegen diese Annahme spricht nicht nur, daß Frau Limbach ihren Exkurs ohne Not in eine Argumentation einbaut, die seiner überhaupt nicht bedarf, jedenfalls dann nicht, wenn man sie insgesamt als den Versuch einer rationalen Darlegung deutet. Auch den Diskutanten im "Reading Room" der FAZ ist bis jetzt nichts aufgefallen (mit einer Ausnahme, die aber keine weitere Beachtung fand). Vielleicht haben wir ja nur geträumt? Ob man nun den morgen (Freitag) wieder die Sprache beobachtenden Rat nimmt, die reformgerechte Wortbildungslehren bastelnden Linguisten, den dudenschwenkenden Sick oder die sprachpatriotische Verfassungsrechtlerin – sie alle simulieren, daß in Wirklichkeit gar nichts passiert sei. Das hat etwas Gespenstisches. |
